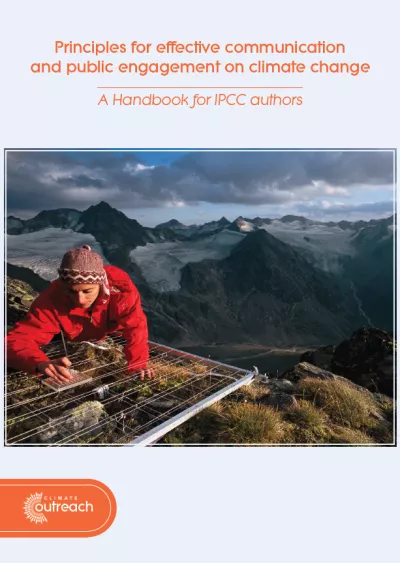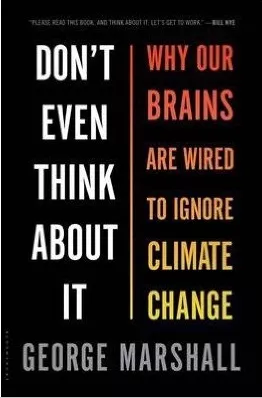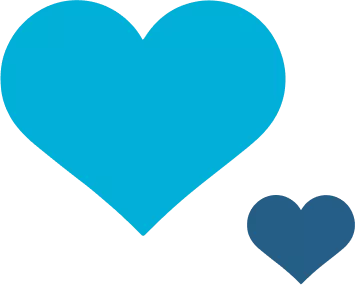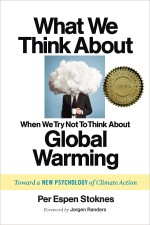 Ein Führungskräfteseminar eines internationalen Ölkonzerns, irgendwo im Süden der USA: Gut hundert Spitzenmanager sitzen beisammen, es geht um die künftige Unternehmensstrategie. Aus den Fenstern des Tagungszentrums hat man einen prächtigen Blick über eine weite Seenlandschaft. Doch die Gegend hat eine jahrelange, extreme Dürre hinter sich, die Pegel der Seen sind um mehr als zwölf Meter gesunken. Wo einst die Ufer waren, sind jetzt breite, schlammige Streifen, die Bootsstege hängen sinnlos in der Luft. Als die Manager einen Ausflug machen, müssen sie eine lange Leiter hinabklettern, um das Boot zu erreichen. Doch draußen auf dem See ist die Laune prächtig, es gibt Champagner. Und das Offensichtliche ist kein Thema: Zunehmende Trockenheit ist genau das, was Forscher infolge des Klimawandels für diesen Teil der USA vorhersagen – die Ölmanager haben also die wahrscheinlichen Folgen ihres Handelns direkt vor Augen. Und ignorieren sie. Mehr noch: Im Plauderton machen sie sich über die wissenschaftlichen Befunde lustig; und die Referenten, die das Thema mehrfach ansprechen, werden in breitem texanischem Dialekt als „europäische Sozialisten“ verspottet.
Ein Führungskräfteseminar eines internationalen Ölkonzerns, irgendwo im Süden der USA: Gut hundert Spitzenmanager sitzen beisammen, es geht um die künftige Unternehmensstrategie. Aus den Fenstern des Tagungszentrums hat man einen prächtigen Blick über eine weite Seenlandschaft. Doch die Gegend hat eine jahrelange, extreme Dürre hinter sich, die Pegel der Seen sind um mehr als zwölf Meter gesunken. Wo einst die Ufer waren, sind jetzt breite, schlammige Streifen, die Bootsstege hängen sinnlos in der Luft. Als die Manager einen Ausflug machen, müssen sie eine lange Leiter hinabklettern, um das Boot zu erreichen. Doch draußen auf dem See ist die Laune prächtig, es gibt Champagner. Und das Offensichtliche ist kein Thema: Zunehmende Trockenheit ist genau das, was Forscher infolge des Klimawandels für diesen Teil der USA vorhersagen – die Ölmanager haben also die wahrscheinlichen Folgen ihres Handelns direkt vor Augen. Und ignorieren sie. Mehr noch: Im Plauderton machen sie sich über die wissenschaftlichen Befunde lustig; und die Referenten, die das Thema mehrfach ansprechen, werden in breitem texanischem Dialekt als „europäische Sozialisten“ verspottet.
Per Espen Stoknes schildert diese Anekdote in seinem neuen Buch What We Think About Global Warming When We Try Not To Think About Global Warming (zu Deutsch etwa: "Was wir denken, wenn wir versuchen, nicht an den Klimawandel zu denken"). Der Norweger ist Psychologe und Ökonom, er hat selbst Unternehmen gegründet und berät heute Firmen in Sachen Strategieentwicklung – eine gute Kombination, um ein Buch über Klimakommunikation zu schreiben.
Auf rund 300 Seiten versucht Stoknes, Elemente "einer neuen Psychologie des Klimaschutzes" zu umreißen. Im ersten Teil des Buches fasst er den Stand der Forschung dazu zusammen, wie Menschen mit klimawissenschaftlichen Informationen umgehen (oder eben nicht umgehen). Im zweiten Teil entwirft Stoknes Strategien, um Klimafakten besser und erfolgreicher zu kommunizieren. In einem dritten, kürzeren Teil erkundet er wie mehr Spiritualität zur Lösung des Klimaproblems beitragen könnte.
Ein bisschen sind wir alle wie die Manager von Ölkonzernen
An den Anfang des Buches stellt Stoknes ein Paradoxon: Die Zahl derjenigen, die sich (zum Beispiel in den USA, aber auch in Norwegen) in Umfragen besorgt zeigen über den Klimawandel, hat seit 1990 abgenommen – obwohl die Faktenlage immer erdrückender wurde, die ersten Auswirkungen der Erderwärmung immer sichtbarer werden. Doch eigentlich, schreibt Stoknes, ist dies nicht paradox, sondern ganz normal: "Es ist unangenehm, mit der Klimabotschaft von Desaster, Zerstörung und drohendem Untergang zu leben." Die Klimafakten werden verdrängt, weil sie unser Leben, unsere Identität bedrohen.
Und ein bisschen seien wir alle wie die texanischen Ölmanager. Wir steigen ins Auto, fliegen in den Urlaub, vergeuden Energie. Würden wir nicht (explizit oder implizit) das Klimaproblem verleugnen, könnten wir kein normales Leben führen - oder würden wahnsinnig werden. „Es mag frustrierend sein für Klimaforscher, dass ihre Botschaften es so schwer haben – für Psychologen aber ist es nicht im geringsten überraschend“, scheibt Stoknes. "Der Mensch neigt dazu, viele Dinge zu leugnen, um sein Selbstwertgefühl zu schützen: Untreue, Ladendiebstahl, Lügen, Neid, was auch immer. Wir leugnen, und dann leugnen wir geschickt, dass wir irgendetwas leugnen."
Was sagen Sozial-, Evolutions- und Kognitionspsychologie?
Auf knapp 80 Seiten gibt Stoknes einen Überblick über die Psychologie des Leugnens. Er schildert die Befunde der Evolutionspsychologie (unser Gehirn ist im Prinzip noch das von Jägern und Sammlern, trainiert zum Beispiel auf Eigennutz und kurzfristige Belohnungen, geübt im Umgang mit klar erkennbaren, personifizierten Gefahren), der Kognitionspsychologie (unser Gehirn ist schlecht im Verarbeiten abstrakter Daten, wissenschaftliche Diagramme erzeugen ein Gähnen, der Klimawandel wirkt räumlich und zeitlich weit entfernt), der Sozialpsychologie (beispielsweise meiden Menschen Informationen, die ihre Meinungen und Handlungen infragestellen und orientieren sich stark an den Meinungen ihres sozialen Umfeldes).
Außerdem ist es ein bekanntes Phänomen, dass Menschen "Risiken herunterspielen, die langweilig, gut bekannt und anonym sind, die kontrollierbar erscheinen, langfristig und natürlich wirken, die graduell zunehmen, auch viele andere betreffen und bei denen es keinen klaren Schuldigen gibt, keinen bad guy". Es dürfte also wenige Probleme geben, auf die der Denk- und Wahrnehmungsapparat des Menschen so schlecht vorbereitet ist, wie auf den Klimawandel.
Dies also ist Stoknes' erster Rat: Klimaforscher und -campaigner sollten nicht sauer sein auf Menschen, die den Klimawandel leugnen. Sie sollten sie nicht verteufeln - sondern akzeptieren, dass es sich um ganz normale, menschliche Reaktionen handelt. Und sie sollten den Vorgang nicht "Verleugnung" des Problems ("denial") nennen, sondern "Widerstand" ("resistance") gegen die Anerkennung des Problems.
"Die Kommunikationsstrategien vieler Klimaschützer sind Teil des Problems"
Sein zweiter Rat lautet: Harte Konfrontation bringt in der Regel wenig. "Psychotherapeuten wissen: Wenn man zu stark gegen die innere Mauer des Widerstands drückt, macht man sie nur noch stärker." Daher seien die Kommunikationsstrategien vieler Klimaschützer inzwischen Teil des Problems: "Wenn die Leute nicht durch wissenschaftliche Fakten zu überzeugen waren, hat man die Fakten wiederholt oder vervielfacht. Oder sie noch lauter gerufen. Oder mit Bildern ertrinkender Eisbären versehen, durch noch düstere Fakten, noch mehr Studien ergänzt. Immer noch keine Reaktion? Ruf' noch lauter!"
Stoknes betont demgegenüber: Klimakommunikation müsse dringend etwas Neues versuchen – die Widerstände nicht direkt angehen, sondern versuchen, sie geschickt zu umgehen. Die Vorschläge hierzu, die in Teil 2 des Buches ausgebreitet werden, sind nicht alle neu. Und sie sind nicht erschöpfend. Aber sind durchaus einleuchtend. Beispielsweise rät Stoknes davon ab, das Publikum mit individuellen Verhaltenstipps zu bombardieren: Die würden allzu oft Schuldgefühle und Abwehr hervorrufen – und wirklich retten könne ein Einzelner das Klima ja sowieso nicht. Verhaltenstipps sollten daher, wenn man denn unbedingt welche geben wolle, stets auch auf strukturelle Veränderungen hinwirken.
Eine Handvoll von Kommunikationsstrategien führt Stoknes dann detaillierter aus:
• Polarisierung vermeiden
Selbst wenn jemand wissenschaftliche Fakten leugnet, sollte man ihn nicht als "Leugner" bezeichnen. Dadurch werden Kommunikation verhindert statt befördert. Und: "Widerstehe dem Impuls, über Forschungsergebnisse zu debattieren und recht behalten zu wollen." Statt über Wissenschaft, solle man besser über Motivation und Gefühle des Gegenüber sprechen, darüber, ob er oder sie bestimmte Klimaschutzmaßnahmen ablehnt, das Klimaproblem für unlösbar hält, sich machtlos fühlt, Angst hat vor Änderungen des Lebensstils etc. pp.
• Nähe herstellen
Der Klimawandel und seine Folgen solle nicht (mehr) als weit entferntes Problem dargestellt werden, sondern konkret, anschaulich, menschlich. Man solle weniger darüber sprechen, wie es um das Jahr 2100 herum in der Antarktis aussehen werde – sondern darüber was mit Menschen und Dingen passiert, die dem Publikum nah und wichtig sind. Also zum Beispiel darüber, welche Folgen der Klimawandel für Angler in Deutschland haben dürfte, für die Qualität von Weinen usw.
• negative Deutungsrahmen meiden
Viel ist in den üblichen Klimadebatten von Unsicherheiten der Forschung die Rede, von Katastrophen und Verzicht. Stoknes empfiehlt stattdessen ein positives "Framing" und meint damit nicht nur, positive Nebeneffekte von Klimaschutz zu betonen (an der Wirksamkeit dieser Strategie bestehen durchaus Zweifel), sondern auch, zum Beispiel andere Analogien zu verwenden. Statt etwa von Kosten für Klimaschutz zu reden, sollten diese als eine Art Versicherungsprämie präsentiert werden: "Wir alle haben eine Feuerversicherung, obwohl wir nicht davon ausgehen, dass unser Haus dieses oder nächstes Jahr abbrennen wird. Wieviel also ist es wert, heute dafür zu zahlen, dass unser Planet in der Zukunft nicht brennt?" Oder: Solarzellen auf dem Dach und eine Batterie im Keller machen unabhängig von Stromkonzernen – mit dieser Begründung ist Photovoltaik selbst bei Teilen der rechtspopulistischen Tea-Party-Bewegung in den USA populär geworden. Stoknes betont aber, dass bei allem neuen "Framing" nicht die üblichen Begründungen für Klimaschutzmaßnahmen vernachlässigt werden sollten.
• gute Geschichten erzählen
Die üblichen Stories von Katastrophen, Gefahren und drohendem Untergang seien nicht nur abgenutzt, meint Stoknes, sie führten auch zu Ohnmacht und Lähmung. Gute Klimakommunikation hingegen müsse gute Geschichten erzählen: von möglichen Lösungen, von Erfindern, von Wissenschaftlern, die spannende Dinge herausfinden und so weiter. Stoknes zitiert hier Adam Corner vom britischen Think Tank Climate Outreach: "Nicht von CO2-Emissionszielen, sondern von menschlichen Geschichten lassen sich die Leute fesseln."
• die Kraft sozialer Netzwerke nutzen
Wie der Konformitätsdruck dazu führe, dass etwa auf Seminaren von Ölmanagern der Klimawandel geleugnet wird, lasse sich der menschentypische Gruppendruck auch ins Positive wenden: Wer erfährt, dass die Nachbarn Wasser sparen, eifert ihnen oft nach. Stoknes führt eine Reihe von Studien auf, die diesen Mechanismus belegen – und praktische Beispiele, wie in Unternehmen, Kleinstädten usw. eine Dynamik für klimafreundliches Verhalten in Gang gesetzt wurde. Statt Individueen zu überzeugen, so Stoknes, sollten Klimakampagnen deshalb viel mehr darauf setzen, das Thema in bestehende Vereine und Verbände, Organisationen und Netzwerke zu tragen.
Bei alledem behauptet Stoknes aber nicht, dass sich mit psychologischen Tricks die Widerstände gegen Klimaschutz vollständig auflösen lassen. Stattdessen betont er zum Beispiel, dass auch gute Kommunikation wenig wird ausrichten können, wenn klimaschonendes Verhalten vom Einzelnen viel Mühe und viele bewusste Entscheidungen erfordert. Es komme deshalb auch darauf an, die förderliche Rahmenbedingungen zu schaffen. Und dies könne häufig ganz im Kleinen beginnen: Bei Computerprintern etwa könne das doppelseitige Drucken doch die Standardeinstellung sein. Und ein Feldversuch in Norwegen habe gezeigt, dass Käufer sich deutlich häufiger für sparsame Haushaltsgeräte entscheiden, wenn auf den Verkaufslabeln nicht nur die Energieeffizienzklasse gezeigt wird, sondern die Kosten des Stromverbrauchs über die voraussichtliche Lebenszeit des Geräts.
Denn selbst bei Leuten, die den Klimawandel als Gefahr akzeptieren, rangiert er nicht sehr weit oben in der Prioritätenliste. "Wir haben schlicht anderen Kram zu erledigen", schreibt Stoknes. Und wir alle haben haufenweise andere Sorgen: die Sicherheit des Jobs, den islamistischen Terrorismus oder auch bloß, heute mal wirklich rechtzeitig von der Arbeit loszukommen, um das Kind pünktlich vom Kindergarten abzuholen...
Per Aspen Stoknes: What We Think About When We Try Not To Think About Global Warming. Toward a New Psychology of Climate Action. Chelsea Green Publishing, White River Junction, Vermont. 320 Seiten, 24,95 $
tst