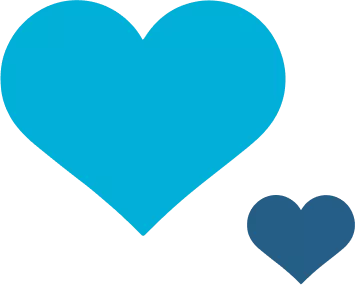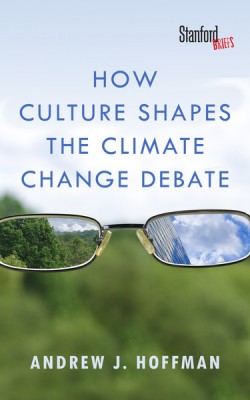 Am Ende seines Buches stellt Andrew J. Hoffman eine kleine Frage: Wenn man sich während einer Familienfeier unverhofft in einem Wortwechsel mit seinem Onkel zum Klimawandel wiederfindet – was sollte man tun? Seine Antwort: „Statt sofort mehr Daten zu präsentieren, um den Sieg einzufahren, sollten Sie lieber überlegen, woher Ihr Onkel kommt.“
Am Ende seines Buches stellt Andrew J. Hoffman eine kleine Frage: Wenn man sich während einer Familienfeier unverhofft in einem Wortwechsel mit seinem Onkel zum Klimawandel wiederfindet – was sollte man tun? Seine Antwort: „Statt sofort mehr Daten zu präsentieren, um den Sieg einzufahren, sollten Sie lieber überlegen, woher Ihr Onkel kommt.“
Mit „Woher“ meint Hofmann den weltanschaulichen Hintergrund, das Wertegerüst des Gesprächspartners. Denn: Mehr Wissenschaft, mehr Sachargumente, mehr Fakten – das ist der Ausgangspunkt des Buches How Culture Shapes the Climate Change Debate – würden für sich genommen nicht die Überzeugungen von Menschen verändern und zu kollektivem Handeln in Sachen Klimaschutz führen. Klar und konzise, auf nicht einmal hundert Seiten, fasst Andrew J. Hoffman, Umweltökonom an der University of Michigan, den aktuellen Stand der sozialwissenschaftlichen Debatte um den Klimawandel zusammen. Das Problem ist für ihn weniger eines der Naturwissenschaften, also von Kohlendioxid, Kohlekraftwerken und zu viel Flugverkehr – sondern eines der menschlichen Gesellschaft, die ja all dies verursacht. Schwierig sei jedenfalls nicht so sehr, die Technologie zu ändern – sondern das Verhalten.
Das Büchlein ist stark aus US-Perspektive geschrieben und der dort regelrecht vergifteten Debattenstimmung geschrieben: Demokraten und Republikaner stehen sich polarisiert gegenüber, fossile Konzerne, marktradikale Think Tanks und konservative Medien schüren aktiv die Zweifel an den Ergebnissen der Klimaforschung, die Wissenschaft oder gar Vorschläge zum Klimaschutz haben es extrem schwer. Wenn das Klimathema politisch und ideologisch so umkämpft ist wie Abtreibung und Homo-Ehe, fragt Hoffman, wie lässt sich trotzdem Wandel erreichen? Seine Antworten und Analysen sind lehrreich auch für den Umgang in einer weniger aufgeheizten Öffentlichkeit.
Wenn ich „Klimawandel“ sage, was hören Sie?
Soziologischen Studien zufolge sind Leute, die sich dem Forscherkonsens zum Klimawandel verweigern, überproportional oft weiß, männlich, älter und konservativ. Und sie tun es weniger aus Unwissenheit (steigt der Bildungsgrad, werden die individuellen Argumentationen der Leugner ausgefeilter), sondern aus ideologischen und weltanschaulichen Gründen. „Wenn ich 'Klimawandel' sage, was hören Sie?“, fragt Hoffman. „Einige hören wissenschaftlichen Konsens und die Notwendigkeit, CO2-Emissionen zu verteuern. Andere hören mehr Regierung, extreme Umweltschützer, Freiheitseinschränkungen, Begrenzung der freien Märkte und vielleicht sogar einen Angriff auf ihr Bild von Gott.“ Wenn der fiktive Onkel am Abendbrottisch in letztere Gruppe gehört, dann lautet Hoffmans Rat: Man solle als erstes Vertrauen aufbauen. Und die Botschaft wie auch die Art der Präsentation (das Framing) bewusst wählen.
Das Verhalten von Menschen in Klimadebatten folge bekannten psychologischen Mechanismen: Wir suchen gezielt Informationen (und Medien), die unsere Haltungen und Überzeugungen bestärken; was diese jedoch angreift, das meiden wir. Von motivated reasoning und confirmation bias sprechen die Fachleute. Dabei orientieren wir uns meist an unserem sozialen Umfeld. Und unsere kulturelle oder politische Identität ist im Zweifelsfall stärker als die Überzeugungskraft wissenschaftlicher Fakten.
Aufbauend auf solchen Einsichten, rät Hoffman, solle man seine Kommunikationsstrategien auch in Sachen Klima gezielt entwickeln. Der Überbringer einer Botschaft ist so wichtig wie die Botschaft selbst, laute einer der wichtigsten Punkte. Deshalb kämen Warnungen vor dem Klimawandel bei skeptischen Zuhörern besser an, wenn sie von akzeptierten Autoritäten stammten: etwa vom Papst oder anderen religiösen Würdenträgern, von Militärs, Angehörigen der eigenen Partei oder von Unternehmern.
Ein weiterer Punkt sei die richtige Wortwahl: „Wenn ich beispielsweise vor Wirtschaftsleuten über den Klimawandel spreche, dann rede ich nicht von CO2-Belastungen, Strahlungsenergie oder gar der sozialen Verantwortung von Unternehmen“, so Hoffman. „Stattdessen fasse ich diese Themen in eine Sprache und in Begriffe, auf die Wirtschaftsleute anspringen: Kapitalkosten, Effizienz, Konsumentennachfrage, Mitarbeiterverpflichtung. … In dieser Denkrichtung kann man den Umgang mit dem Klimawandel als umfassendes Risikomanagement betrachten. Ähnlich wie der Hausbesitzer eine Feuerversicherung abschließt, um sich gegen diese Gefahr mit großer Schadenshöhe und niedriger Eintrittswahrscheinlichkeit abzusichern, könnte man nach einer Art Prämienzahlung suchen für ein Ereignis mit dem Schaden-Wahrscheinlichkeits-Profil des Klimawandels.“
„Never waste a good crisis“
Welchen Einfluss Begründungen auf individuelles Verhalten haben, illustriert Hoffman unter anderem mit Umfragedaten aus dem vergangenen US-Präsidentschaftswahlkampf: Damals hatten mehr Anhänger des Republikaners Mitt Romney Energiesparmaßnahmen an ihrem Haus ergriffen als Anhänger von Barack Obama. Auf die Frage nach der Motivation nannten sie aber nicht Umweltgründe, sondern die Möglichkeit, damit Geld zu sparen. Einer Studie zufolge griffen konservative Konsumenten häufiger zu Energiesparlampen, wenn sie neutral verpackt waren als wenn auf der Schachtel mit dem Nutzen für die Umwelt geworben wurde.
Weitere Ratschläge des Buches lauten: Man möge nicht so sehr wissenschaftliche Fakten kommunizieren, sondern die Verlässlichkeit des wissenschaftlichen Prozesses oder die überwältigende Größe des Forscherkonsens' (dass er 97 Prozent erreicht, zählt Studien zufolge zu den effektivsten Klimabotschaften überhaupt). Klimawandel solle in konkrete, persönliche Erfahrungen übersetzt werden, etwa in Extremwetter (ein Obama-Berater wird mit dem Bonmot zitiert, man dürfe nie eine gute Krise verschenken). Allerdings seien Horrorszenarien wie im Hollywood-Eiszeit-Schocker The Day After Tomorrow eher kontraproduktiv. Stattdessen sollten Lösungen für die Klimakrise vermittelt werden – und zwar solche, die mit konservativen Werten vereinbar sind (Klimaanpassung zur Bewahrung nationaler Stärke etc.) Außerdem sei es hilfreich, weniger die Umwelt als bedroht darzustellen, als vielmehr die öffentliche Gesundheit.
Der Wandel von Einstellungen und politischen Kulturen könne lange dauern, mahnt Hoffman, man möge sich davon nicht entmutigen lassen. Er vergleicht die Klimadebatte mit jener um die Sklaverei im 18. Jahrhundert oder der hitzigen, ebenfalls von Lobbytricks begleiteten Auseinandersetzung um die Schädlichkeit des Rauchens, die jahrzehntelang wogte. Hoffman plädiert deshalb für Kompromisse mit ideologischen und wirtschaftlichen Interessen, die bei Klimaschutz verlieren und durchaus für Kompensationszahlungen. Vor allem aber solle man sich nicht so sehr um die Vertreter von Extrempositionen kümmern – sondern um gemäßigte Skeptiker und die oft unentschiedene Mitte. Hier gelte es als erstes Vertrauen aufzubauen und Anknüpfungspunkte zu suchen, Fakten und Argumente sollten erst später folgen. „Wollen wir Leuten einen gesichtswahrenden Weg ebnen, um zu eigenen Schlussfolgerungen zu kommen - oder wollen wir gewinnen, sie zur Kapitulation zwingen?“
Und wenn der fiktive Onkel sich als gefestigter Leugner entpuppt, dann sei es vielleicht am besten, das Thema zu wechseln, vielleicht zu Fußball – und die Familienfeier zu genießen.
Andrew J. Hoffman: How Culture Shapes the Climate Change Debate. Stanford University Press 2015, 110 Seiten, € 12,85
tst