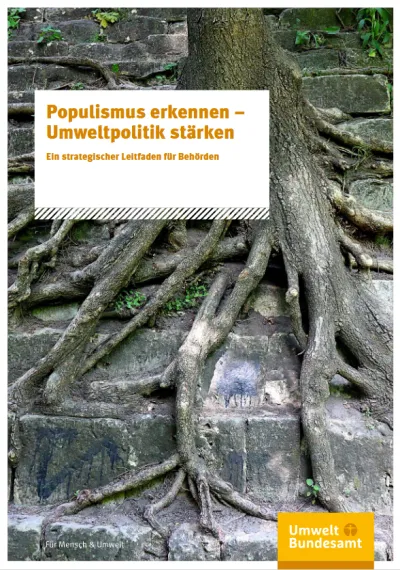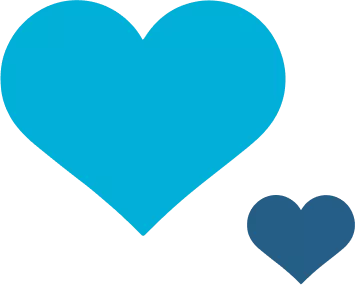Svenja Schröder setzt auf Diplomatie und positive Botschaften. Seit Ende 2020 arbeitet die 37-Jährige als Klimaschutzmanagerin im nordrhein-westfälischen Rietberg. Als solche ist es ihr Job, die Kommune auf dem Weg in eine klimafreundliche Zukunft zu begleiten. Dazu initiiert sie Klimaschutzvorhaben innerhalb der Verwaltung und draußen in der Stadt, und sie koordiniert den Austausch mit weiteren Akteuren der Kommunalpolitik, mit Rietberger Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern.
Deutschland muss bis 2045 klimaneutral sein, so schreibt es das Bundesklimaschutzgesetz vor. Konkret: Ab 2045 dürfen im ganzen Land keine Treibhausgase mehr in die Atmosphäre entlassen werden. Unvermeidbare Rest-Emissionen müssen ausgeglichen werden, etwa durch das das Aufforsten von Wäldern, das Renaturieren von Mooren, das Abscheiden und eventuelle Wiederverwenden von CO2.
Ob Deutschland seine Klimaziele erreicht, entscheidet sich zu einem Gutteil auch in den Kommunen. Viel zu tun also für Leute wie Svenja Schröder. In der Bevölkerung gibt es große Mehrheiten für Klimaschutz (auch wenn die Unterstützung der Klimabewegung zuletzt zurückgegangen sein mag). In Umfragen sehen zum Beispiel 80 Prozent oder mehr der Bürgerinnen und Bürger „großen oder sehr großen Handlungsbedarf“ beim Klimaschutz – und zwar quer durch alle Parteien (außer der AfD).

Ob Deutschland seine Klimaziele erreicht, entscheidet sich weitab der Hauptstadt, auf die sich die Medienaufmerksamkeit oft konzentriert. Wir haben mal in den Regionen und Kleinstädten geschaut, was dort die Klimadebatte prägt und kompliziert macht; Foto (Marktplatz von Zittau, Sachsen): Carel Mohn
Doch natürlich gibt es auch Konflikte, und je mehr die Zeit drängt für Emissionssenkungen, desto stärker und lauter werden auch die Widerstände. Das ist etwa in der 31.000-Einwohner-Stadt Rietberg und anderen Städten und Gemeinden zu spüren. Spricht man mit kommunalen Klimaschutzmanagerinnen und -managern, kann man unterschiedliche Geschichten über die Konflikte hören – sie hängen zum Beispiel ab von den politischen Kräfteverhältnissen am Ort, der finanziellen Ausstattung der Kommunen und Landkreise oder auch davon, welche Themen gerade auf Bundesebene besonders umkämpft sind.
Besonderes Aufsehen erregte im Frühjahr der thüringische Ilm-Kreis. Damals ging er durch die sogenannten Sozialen Netzwerke, weil der Kreistag mit den vereinten Stimmen von CDU, FDP, Freien Wählern und AfD die Einrichtung einer Klimaschutzagentur inklusive zweier zu hundert Prozent vom Bund geförderter Stellen ablehnte. Die Agentur hätte die Kommunen im Kreis in der Klimawende unterstützen und den Klimaschutz strategisch planen sollen. Offenbar signalisierten einige Bürgermeister auch Bedarf. Doch dann kam die Niederlage im Kreistag.
Medienberichten zufolge sah die AfD keinen Bedarf, überhaupt etwas gegen den Klimawandel zu unternehmen. Die CDU fürchtete wohl, dass der Kreis nach dem Auslaufen der Förderung die beiden Stellen selbst finanzieren müsse. Die Freien Wähler forderten, die Kommunen sollten sich selbst um den Klimaschutz kümmern, und warnten trotz der hundertprozentigen Förderung, dass die Agentur enorme Haushaltsmittel verschlingen würde. Die Befürworter konnten sich jedenfalls am Ende nicht durchsetzen. Die Stärke der AfD scheint an etlichen Orten in Thüringen ein Problem zu sein, vor allem, wo auch CDU und FDP beim Klimaschutz bremsen oder gar dagegen polemisieren.
Akzeptanz unterscheidet sich regional …
Die Art und Heftigkeit von Konflikten, die der Klimaschutz in den Kommunen auslöst, hängen deutlich ab von der Gegend, in der man lebt und arbeitet. Im vergangenen März stellte eine Analyse des Kopernikus-Projekts Ariadne „erhebliche regionale Unterschiede in der Zustimmung von Klimaschutzmaßnahmen in der deutschen Bevölkerung“ fest – die Details zeigt ein interaktives Online-Dashboard. Ob die Menschen eine einzelne Klimaschutzmaßnahme positiv bewerteten, „variierte teilweise um bis zu 60 Prozentpunkte“, erklärten die Forschenden.
So war die Zustimmung zur Klimawende in Städten allgemein höher als auf dem Land, im Westen vielfach höher als im Osten, im Norden höher als im Süden. Manche Werte hatten sich im Lauf der Zeit verändert: „In Ostdeutschland ist die Zustimmung zum Windkraftausbau gestiegen“, sagt Ingo Wolf, Sozialwissenschaftler am Forschungszentrum für Nachhaltigkeit – Helmholtz-Zentrum Potsdam (RIFS) und maßgeblich an der Studie beteiligt. Die Unterschiede zwischen West und Ost seien deshalb geschrumpft. Beim Kohleausstieg hingegen sei es genau umgekehrt, der polarisiere „trotz Kohlekommission und den Fördermaßnahmen für die betroffenen Regionen“ stärker als zuvor.
… und verändert sich über die Zeit hinweg
Daneben zeigt das Ariadne-Dashboard beispielsweise im Detail: Die Zustimmung zu Maßnahmen, die den Zugang von Verbrenner-Autos in Städte begrenzen sollen, fällt in den allermeisten Regionen eher gering aus. Hingegen ist die Unterstützung für Solaranlagen auf Hausdächern oder Freiflächen ist in den vergangenen Jahren bundesweit leicht gestiegen.

Svenja Schröder,
Klimaschutzmanagerin der Stadt Rietberg (Nordrhein-Westfalen)
(Foto: BVKS)
Beides passt zu den Erzählungen der Klimaschutzmanagerinnen und -manager, mit denen klimafakten.de für diesen Artikel gesprochen hat. Svenja Schröder zum Beispiel sagt: „Das Auto ist in Deutschland so etwas wie ein Heiligtum.“ Alles, was den individuellen Autoverkehr einschränken würde, „ob nur Parkplätze wegfallen sollen oder es um die Idee einer komplett autofreien Stadt geht“, sei praktisch nicht konstruktiv zu diskutieren. In Rietberg zogen sie deshalb Konsequenzen: „Wenn es um Mobilität geht, machen wir nur nette Sachen, zum Beispiel fördern wir den Kauf von Lastenrädern.“ Dinge aber, die von Autofahrern Verzicht verlangen würden, werden erst einmal nicht angegangen.
Dass die Verkehrswende ein schwieriges Thema ist, schildern auch alle anderen der befragten Fachleute. „Noch traut sich niemand, das Auto in Frage zu stellen“, sagt beispielsweise Peter Glasstetter, 48, Sachbearbeiter für Klimaschutz und Klimaanpassung im Umweltamt Wiesbadens. „Die Verringerung des individuellen Verkehrs zugunsten von Rad und ÖPNV wird kontrovers diskutiert“, formuliert etwas diplomatischer Frank Leipe. Der 60-Jährige organisiert für die Energieagentur Thüringen (ThEGA) ein Netzwerk der kommunalen Klimaschutzmanager und -managerinnen im Bundesland.
Einer von ihnen bestätigt den anderen Ariadne-Befund: In seinem Landkreis in Thüringen stünden die Menschen inzwischen den erneuerbaren Energien offener gegenüber als früher – auch, weil viele ein Eigeninteresse sähen. „Sie fragen: Wie kann ich mich wirtschaftlich verbessern?“ Lokale Energiegenossenschaften zeigten „sehr schön“, wie das funktionieren könne. Am Telefon berichtet der Fachmann lang und ausführlich von seinen Erfahrungen: Was gut funktioniert, was nicht so gut klappt, wie er die Menschen überzeugt, und welchen Konflikten er sich im Alltag gegenübersieht. Doch dieses Gespräch zeigt auch, wie heikel das ganze Klimathema vor Ort häufig ist: Aus Sorge, seinem Anliegen zu schaden, wenn er in diesem Text namentlich auftaucht oder sein Landkreis erkennbar ist, möchte er lieber anonym bleiben.
Ein diplomatischer Balanceakt
Um den Klimaschutz neu in Kommunen zu verankern und zu verstetigen, sei es ratsam, nicht nur „auf die eingesparten Tonnen an CO2 durch die ersten Maßnahmen zu schauen“, schreibt die Bertelsmann Stiftung im Bericht „Monitor Nachhaltige Kommune“ aus dem Jahr 2020. Die Erfahrungen von Klimaschutzmanagerinnen und -managern hätten gezeigt, dass „zwei Maßnahmentypen in Kombination besonders effektiv“ gewesen seien: „Erstens die Durchführung einer für die Öffentlichkeit und/oder Verwaltung und Politik besonders sichtbaren Maßnahme mit hoher Erfolgswahrscheinlichkeit. Zweitens eine intensive Öffentlichkeitsarbeit und Bekanntmachung des Gesichts und der Person, die für das Klimaschutzmanagement vor Ort verantwortlich ist, verbunden mit dem Aufbau eines Netzwerkes an Unterstützenden und Veränderungswilligen.“
Ganz unabhängig von einzelnen Themen, die besonders umstritten sein mögen, kristallisieren sich aus den Gesprächen mit den kommunalen Klimaschutzfachleuten drei Erkenntnisse heraus. Die erste: Oftmals scheint es ein diplomatischer Balanceakt zu sein, den kommunalen Klimaschutz voranzutreiben – denn wie viel Spielraum die Klimaschutzmanagerinnen und -manager haben, hängt immer von Entscheidungen der Politik ab. „Man darf sich bei der Politik nicht unbeliebt machen. Sonst erreicht man gar nichts mehr“, sagt Svenja Schröder aus Nordrhein-Westfalen deshalb. Frank Leipe aus Thüringen wünscht sich eine stärkere Stellung der Klimaschutzmanagerinnen und -manager – und mehr Geld für kommunalen Klimaschutz.
Knappes Geld, schwierige Verbote
Das ist die zweite Erkenntnis: Finanzierung ist oftmals ein Problem. Denn für die Kommunen ist Klimaschutz immer noch eine freiwillige Aufgabe, keine Pflicht. „Im Zweifel ist die Errichtung von Unterkünften für Geflüchtete dann wichtiger, als ein städtisches Gebäude mit Photovoltaik auszustatten“, sagt Schröder. Die Konsequenz: Oft wird am Klimaschutz gespart.
Die dritte Erkenntnis: Gerade, weil es darum geht, die Menschen im Ort zu überzeugen, treffen Anreize in der Bevölkerung üblicherweise auf mehr Zustimmung als Verbote und Einschränkungen. Auch das deckt sich mit den Erkenntnissen des Akzeptanzforschers Ingo Wolf: „Die Menschen geben ihre Entscheidungsfreiheit ungern ab. Das ist in unserer Kultur tief verankert; dazu gibt es auch robuste Erkenntnisse aus der Forschungsliteratur.“
Schröder und Glasstetter berichten über die Schwierigkeiten nicht nur aus eigener Erfahrung, sondern auch aus den Berichten von Kolleginnen und Kollegen aus dem Bundesverband Klimaschutz (BVKS), in dem sich beide engagieren. In dem Verband haben sich Klimaschutzbeauftragte, die größtenteils in den Kommunen arbeiten, zusammengetan, um sich gegenseitig zu unterstützen. Nur 30 bis 40 Prozent aller Städte und Gemeinden in Deutschland beschäftigten überhaupt Klimaschutzmanagerinnen und -manager, schätzt Schröder (andere Schätzungen liegen teils deutlich niedriger). Umso wichtiger sei die überregionale Vernetzung, so Schröder. Derzeit habe der BVKS rund 200 Mitglieder.
Befristete Verträge, schwache Stellung
Oft hätten ihre Kolleginnen und Kollegen in den Kommunen keinen leichten Stand. Das hat auch damit zu tun, dass ihre Arbeitsverträge in der Regel auf zwei Jahre befristet sind, weil sie durch ein Förderprogramm des Bundes finanziert werden, das den Klimaschutz in den Kommunen anschieben soll. Eine einmalige Verlängerung ist zwar möglich, doch dass die Stellen entfristet werden und sich damit fest in den kommunalen Verwaltungsstrukturen etablieren, gelinge nur in etwa der Hälfte der Fälle, sagt Schröder.

Frank Leipe
koordiniert für die Energieagentur Thüringen (ThEGA) ein Netzwerk der kommunalen Klimaschutzmanager und -managerinnen im Bundesland
(Foto: ThEGA)
„Befristete Jobs sind vor allem für Berufsanfänger und Enthusiasten interessant“, kritisiert ThEGA-Mann Leipe. „Wer Berufserfahrung hat und eine Familie versorgen muss, möchte eine gesicherte Perspektive.“ Als Berufsanfänger aber, der „in der Hierarchie einer städtischen Verwaltung nicht weit oben angesiedelt ist und auf politische Befindlichkeiten Rücksicht nehmen muss“, sei es eine große Herausforderung, eine Kommune bis 2045 in die Klimaneutralität zu führen. Zumal in Thüringen, wo es angesichts der politischen Verhältnisse „schwierig“ sei, Klimaschutzkonzepte mit konkreten Entwicklungspfaden für den Wind- und Solarausbau und die Energieeffizienz vorzulegen, die das 2045er-Ziel erreichen könnten.
„Einige Parteien in Thüringen stellen sich gegen den Ausbau der Windenergie“, sagt Leipe. „Stellen Sie sich einen jungen Klimaschutzmanager vor, der einen Vertrag über zwei Jahre hat und gerne eine Verlängerung seiner Stelle möchte. Wenn er sich hinstellt und sagt: Ich habe durchgerechnet, wie wir 2045 klimaneutral sein können und wie viele Windräder das bei uns bedeutet, dann könnte er kräftigen Gegenwind bekommen.“
„Wir sind ‚Change Maker‘. Aber ohne die Politik können wir gar nicht so viel tun“
Schröder erlebt es im nordrhein-westfälischen Rietberg weniger drastisch. Aber auch sie sagt, ein grundsätzliches Problem eine alle BVKS-Mitglieder: „Wir sind ‚Change Maker‘. Unser Auftrag ist es, Veränderungen im Sinne des Klimaschutzes voranzutreiben. Aber wir können selbst keine Entscheidungen treffen. Weil wir Teil der kommunalen Verwaltung sind, hängt unsere Arbeit immer von politischen Beschlüssen ab.“ Das bedeutet: „Ohne die Politik – also ohne Ratsbeschlüsse mit möglichst klaren, konkreten Klimaschutzaufträgen an die Verwaltung, oder ohne verbindliche Vorgaben aus der Landes- und Bundespolitik – können wir gar nicht so viel tun“.
Doch in Stadt- und Gemeinderäten seien klare politische Beschlüsse für den Klimaschutz oft schwer zu erwirken. Oft stimmten die Gremien zwar dem Klimaschutzkonzept der Verwaltung grundsätzlich zu, sagt Schröder, stellten aber zugleich jede einzelne Maßnahme zur Umsetzung unter Vorbehalt. So bleibe alles vage und unverbindlich. Manchmal fühle sie sich alleingelassen, sagt Schröder, denn in der Rietberger Verwaltung ist sie die einzige für Klimaschutz zuständige Person. Gerade in Klein- und Mittelstädten seien Klimaschutzmanager oft Einzelkämpfer. Umso geschickter müssten sie dann in der Kommunikation sein – ob mit ihren Vorgesetzten in der Verwaltung, dem Bürgermeister, den gewählten Gemeinderäten oder der breiten Öffentlichkeit.
Freiwilligkeit oder Pflicht? So oder so: Vielen Kommunen fehlt das Geld
In Wiesbaden ist ihr Kollege Glasstetter in einer etwas komfortableren Situation. „Personell sind wir mittlerweile mit insgesamt acht Stellen nicht schlecht aufgestellt“, sagt er. Und die politische Basis für seine Arbeit sei gut: In der Stadtverordnetenversammlung arbeiteten SPD, Linke, Grüne und Volt zusammen, „die sind zum Teil sehr ambitioniert in ihren Beschlüssen, darüber können wir uns nicht beschweren“. Auch in der Vergangenheit seien in Wiesbaden ehrgeizige Klimapolitik-Beschlüsse gefasst worden. „Ich habe in meiner Arbeit hier noch nicht erlebt, dass wir uns rechtfertigen müssten“, sagt Glasstetter.

Peter Glasstetter,
Sachbearbeiter für Klimaschutz und Klimaanpassung im Umweltamt Wiesbaden
(Foto: privat)
Auch Geld scheint für Wiesbadens kommunale Klimapolitik nicht das Problem zu sein. Doch andernorts könnte die Furcht vor zusätzlichen, womöglich nicht vorhersehbaren Ausgaben hinter den unverbindlichen oder ablehnenden Beschlüssen der Lokalpolitik stecken.
ThEGA-Mann Leipe hingegen berichtet von einem Bürgermeister, der den Klimaschutz voranbringen möchte, aber selbst für Pflichtaufgaben zu wenig Geld hat. „Die kommunalen Gebäude sind sanierungsbedürftig, die Baupreise explodieren, und dann kommt halt noch ein weiteres Gesetz aus Berlin, dass man mangels finanzieller Mittel nicht erfüllen kann.“ Die Bürgermeister und Landräte müssten sich vor Ort „ständig dafür rechtfertigen, dass sie Geld für den Klimaschutz ausgeben“, sagt Leipe. „Und der Widerstand gegen die Windkraft kommt in Thüringen noch hinzu.“
Das Problem: Würde Klimaschutz für die Kommunen Pflicht – wofür ein Rechtsgutachten spricht und was verschiedene Verbände fordern –, könnten sie die dafür bisher existierenden Förderprogramme nicht mehr in Anspruch nehmen, denn die sind nur für freiwillige Aufgaben gedacht. Erhielten die Kommunen den Klimaschutz als Pflichtaufgabe, müssten sie vom Land gemäß dem Konnexitätsprinzip mit entsprechenden Finanzen ausgestattet werden. „Das ist derzeit nicht in Sicht“, sagt Leipe.
Vorteile und Chancen stärker betonen als etwaige Risiken
Svenja Schröder aus Rietberg kommuniziert, wenn sie Konflikte erwartet, gern per „Subtext“, wie sie es nennt. Damit meint sie: „Botschaften zu transportieren, ohne dass man sie genau benennt. Beispielsweise über Bilder, oder indem ich Vorteile und Chancen stärker betone als etwaige Risiken.“ Statt Kritik zu äußern oder Schuldfragen zu stellen, wenn Klimaschutz hakt, wende sie den Blick lieber nach vorne und beschreibe, „wie wir gemeinsam viel für eine gute Zukunft bewegen können“.
Wie das funktioniert, beschreibt sie am Beispiel des kommunalen Förderprogramms Klimaschutz, das in Rietberg seit 2020 existiert. Damit unterstützt die Stadt beispielsweise Immobilienbesitzer, die energiesparende Fenster einbauen lassen, das Dach begrünen oder eine Wärmepumpe installieren. Anfänglich sei im Gemeinderat viel darüber diskutiert worden, ob die Förderung auch gewährt werden solle, wenn Anträge erst nach Umsetzung gestellt würden. „Die Politik fürchtete Mitnahmeeffekte“, erinnert sich Schröder. Doch sie machte sich dafür stark, klimafreundliche Investitionen auch im Nachhinein zu belohnen. „Ich habe positiv argumentiert und auf den Multiplikatoreffekt verwiesen“, also darauf, dass die Freude über eine unverhoffte nachträgliche Förderung weitergetragen würde und so andere Menschen dazu bewegen könnte, ebenfalls zu investieren. „Das hat sich dann auch genauso bestätigt.“
Was hilft? Raus zu den Leuten, und: Netzwerke knüpfen
Viele Konflikte entstünden, weil die Kommunikation nicht so gut funktioniere, sagt ihr Thüringer Kollege, der lieber anonym bleiben möchte. Um die Menschen „abzuholen“, reiche eine Pressemitteilung nicht – viel wichtiger sei es, aktiv den Kontakt zu suchen, beispielsweise durch Info-Veranstaltungen, Solar-Konstruktionswettbewerbe, Schulbesuche oder ganz konkrete Beratungsangebote, etwa zu Gebäudesanierung oder Heizung.
Daneben rät er allen Kolleginnen und Kollegen, sich zu vernetzen, und zwar möglichst so, dass man nicht nur am Arbeitsort gute Kontakte habe, sondern im ganzen Bundesland und auch darüber hinaus. Die Aufgaben seien komplex, sagt er, und ohne Netzwerk schaffe man es nicht. Die Energiewende umzusetzen, gelinge nur, „wenn die unterschiedlichsten Menschen miteinander reden.“
Nächste Herausforderung Wärmewende
Die nächste große Herausforderung für die kommunalen Klimaschutz-Verantwortlichen wird die Wärmewende sein. Allerdings scheint die in den Städten und Gemeinden bisher noch nicht so aufgeheizt diskutiert zu werden wie in der Bundespolitik oder manchen Medien. Die Klimaschutz-Verantwortlichen berichten eher von erhöhtem Beratungsbedarf der Bürgerinnen und Bürger. Und von ganz pragmatischen Fragen, die die Stadtverwaltungen derzeit umtreiben: Die Bundesregierung will die Kommunen gesetzlich verpflichten, bis 2028 eine eigene Wärmeplanung vorzulegen – doch vielerorts gibt es noch keine genauen Daten darüber, wie die einzelnen Gebäude in der Stadt überhaupt mit Heizenergie versorgt werden.

Wie die lokale Akzeptanz von Klimaschutz-Maßnahmen ausfällt, hat viel damit zu tun, wie über sie gesprochen wird. Eine kommunale Klimaschutzmanagerin rät: Statt Kritik zu äußern oder Schuldfragen zu stellen, den Blick lieber nach vorn wenden und beschreiben, „wie wir gemeinsam viel für eine gute Zukunft bewegen können“; Foto (Stadtfest in Scheßlitz, Oberfranken): Carel Mohn
Rietberg etwa hat kein kommunales Wärmenetz. „Hier versorgt sich jeder selbst“, sagt Schröder, „die meisten nutzen Gas. Aber es ist nicht so, dass wir darüber 100prozentige Informationen hätten.“ Die neue Pflicht zur Wärmeplanung heißt für sie deshalb zunächst: Die Daten müssen beschafft werden. „Wie alt sind die Gebäude? Wann wurden sie saniert, in welchem Zustand sind sie? Wie alt ist die Heizung? Womit wird überhaupt geheizt?“ zählt Schröder die offenen Fragen auf.
Die Antworten soll nun ein Quartiersmanager beschaffen, der im Februar eingestellt wurde – eigentlich, um die Bürgerinnen und Bürger in zwei Quartieren zuhause aufzusuchen und ihnen eine Beratung zu allen Fragen der Wärmewende anzubieten. Erst einmal jedoch wird er mit der Datenerhebung beschäftigt sein.
In Hessen greife die Verpflichtung zur kommunalen Wärmeplanung ab November, sagt Glasstetter. Doch auch hier hätten die Kommunen erst im Frühjahr anfangen können, die nötigen Daten „anschlussscharf“ zu beschaffen, sagt Glasstetter. „Vorher fehlte uns die gesetzliche Grundlage.“
Er sieht die neuen Gesetze zur Wärmewende – also Wärmeplanungs-, Gebäudeenergie- und Energieeffizienzgesetz – deshalb „alle als Punkte, die uns in die Hände spielen, weil die Kommunen durch sie handeln müssen“. Sollten die drei Gesetze wie geplant in Kraft treten, hätten er und seine Kolleginnen und Kollegen eine klarere Grundlage für ihre Arbeit. Auch unsichere oder wechselnde politische Mehrheiten vor Ort könnten dies nicht mehr ändern. Sobald die Kommunen zu einer Aufgabe verpflichtet seien, spare das Diskussionen, sagt Glasstetter. „Das ist eine sinnvolle Unterstützung. Für alles andere haben wir einfach nicht mehr die Zeit.“
Alexandra Endres
In der vergangenen Woche haben wir den Soziologen Fritz Reusswig interviewt
zu populistischen Einstellungen in Teilen der Gesellschaft, was sie für Klimapolitik bedeuten
und wie man kommunikativ darauf reagieren kann
Über gesellschaftliche Einstellungen zum Klimawandel und den Umgang mit populistischen Angriffen auf Klimapolitik haben wir ausführlich in diesem Interview mit dem Soziologen Fritz Reusswig gesprochen.