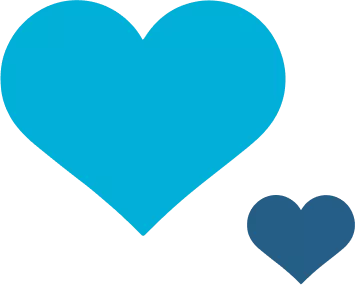Der Hurrikan "Katrina" 2005 hat in den USA die Suizidrate drastisch steigen lassen. Nach einer Überflutung im bayerischen Simbach begeben sich Dutzende Bewohner in psychiatrische Behandlung. Die renommierte US-Klimaforscherin Camille Parmesan verfällt nach der Mitarbeit an drei IPCC-Reports in, wie selbst es nannte, "professionelle Depression" - weil offenbar niemand die Warnungen der Wissenschaft hören will.
Die Beispiele machen deutlich: Der Klimawandel und die mit ihm zusammenhängenden Extremwetterereignisse haben häufig sehr einschneidende Folgen - weggeschwemmte Häuser, zerstörte Brücken, getötete Menschen. Doch während solche physischen Schäden große Aufmerksamkeit bekommen, hat sich für die psychischen Folgen der Erderwärmung lange Zeit kaum jemand interessiert. In einem ausführlichen Text für das Online-Magazin Riff-Reporter gibt der Hamburger Wissenschaftsjournalist Christopher Schrader nun einen Überblick über den Stand der Forschung. Nicht nur die zunehmende Zahl von Wetterextremen infolge des fortschreitenden Klimawandels werde für vermehrte mentale Probleme sorgen, schreibt er. Die spezifische Ursache wirkt als zusätzlicher Stressfaktor: "Wenn ein Ereignis, gar eine Katastrophe, als von Menschen verursacht erlebt wird, dann wirkt sie viel traumatisierender, als wenn es reine Naturgewalt wäre", zitiert Schrader eine Psychiaterin aus Simbach.
"Solastalgia" - Schmerz darüber, dass ein geliebter Ort bedroht ist
In der angelsächsischen Welt sei die Diskussion zum Thema schon weit fortgeschritten, dort näherten sich Fachleute dem Thema auch mit neuen Begriffen geprägt - etwa "Solastalgia", eine Neuschöpfung aus solace (Trost) und nostalgia, also der Sehnsucht nach Vergangenem bzw. Vergehendem. "Es ist der Schmerz, dass der Ort, an dem man wohnt und den man liebt, unmittelbar bedroht ist", zitiert Schrader den Umweltphilosophen Glenn Albrecht von der University of Newcastle in Australien, der den Begriff 2005 prägte. Mit dem Ort könnten dann auch Gefühle von Identität und Zugehörigkeit sowie die Kontrolle über das eigene Leben in Gefahr geraten. Schrader: "Wer bisher in schweren Zeiten die Seele im Bergtal oder am Strand ins Lot brachte, kann aus dem Gleichgewicht geraten, wenn diese Orte durch den Klimawandel beschädigt oder zerstört werden."
Zeitgleich mit Schraders Text erschien auf der Wissensseite der Süddeutschen Zeitung ein Artikel zum selben Thema. Autorin Jana Hauschild zählt darin weitere Beispiele auf für psychische Probleme infolge des Klimawandels: vermehrte Angsterkrankungen und Traumata unter Briten, die bei der Flut 2013/14 ihr Haus verloren; eine Zunahme von Suchterkrankungen und Selbsttötungen bei den Inuit, denen der Schwund des arktischen Meereises die Grundlage des gewohnen Lebens raubt.
Hitzewellen führen zu einer Zunahme von Aggressivität und Gewalt
Doch langfristig, so Hauschild, drohen nicht nur psychische Erkrankungen, sondern auch eine veränderte Gesellschaft. "Das von der US-Regierung initiierte US Global Change Research Program berichtet von mehr Gewalt in Kommunen, die von einer Naturkatastrophe heimgesucht wurden", schreibt sie. "Vor allem die Fälle häuslicher Übergriffe gegen Frauen und Kinder stiegen dann an. Warum das so ist, dafür gibt es viele Theorien. Sie reichen von Überforderung bis zum Versuch der Täter, wieder ein Gefühl von Kontrolle über etwas oder über andere zu erlangen."
Relativ gut belegt sei zudem, dass Hitzewellen aggressiv machen. "Steigen die Temperaturen in unerträgliche Höhen, erhitzt das wortwörtlich die Gemüter. Hitze blockiert logisches Denken, lässt Menschen ungehalten werden, und teilweise gewalttätig", so Hauschild. Der US-Politikwissenschaftler Matthew Ranson habe bereits ausgerechnet, wie stark die Kriminalität im Land durch vermehrte Hitzewellen infolge des Klimawandels zunehmen dürfte: um 340 Morde und 18.000 Fälle schwerer Körperverletzung pro Jahr.
tst