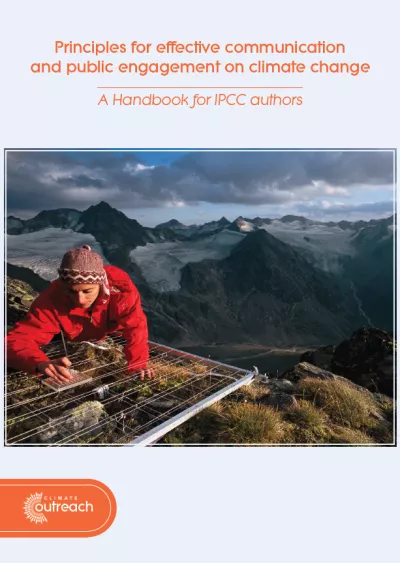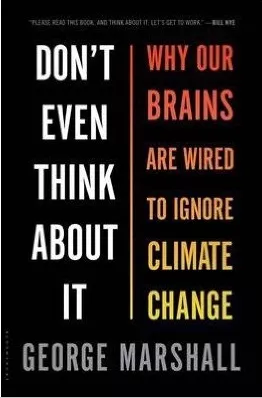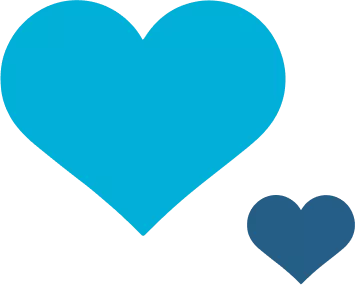Müll trennen, die Heizung herunterdrehen, Flüge vermeiden, weniger Fleisch essen - Ratschläge wie diese für ein umwelt- und klimafreundlicheres Handeln hören Menschen in den Industrieländern seit Jahrzehnten. Doch tiefgreifend geändert hat sich ihr Verhalten nicht. Diese ernüchternde Diagnose steht am Beginn eines Überblicksartikels, den vier Umweltpsychologinnen und -psychologen aus St. Paul im US-Bundesstaat Minnesota im Forschungsjournal Science veröffentlicht haben.
Weder die Vermittlung von Information noch von Schuldgefühlen oder Angst habe viel gebracht, schreiben sie - und fragen, wie das zu erklären sei. Und was man denn stattdessen tun könne. "Diese Fragen zu beantworten", kommentiert John Abraham im Guardian, "ist möglicherweise eine noch größere Herausforderung als die Grundlagenforschung zum Klimawandel."
Psychologische Hindernisse für Verhaltensänderungen ...
In dem Aufsatz, der Teil eines kürzlich in Science erschienenen Themenschwerpunkts zum "Ökosystem Erde" ist, fasst das Team um Elise Amel von der St. Thomas University also den Stand der psychologischen Forschung zur Klimakommunikation zusammen. Eine ganze Reihe von Hindernissen erschwere es, Verhaltensänderungen zu erreichen. Beispielsweise sei der Sinnes- und Denkapparat, den der Mensch im Laufe der Evolution entwickelt hat, für das Leben in der Moderne schlicht nicht gut geeignet. Menschen seien etwa darauf trainiert, plötzliche und offensichtliche Gefahren (wie den Angriff eines Raubtiers) zu erkennen und auf sie zu reagieren – aber schlecht gerüstet, langsame und nicht direkt sichtbare Verschlechterungen der Umwelt (wie den Klimawandel oder das Artensterben) überhaupt zu bemerken. Doch ohne greifbares Signal für die Sinne und einhergehenden emotionalen Ruck fühlen sich diese Probleme weit entfernt an - und bewegen uns eben nicht zu Handlungen.
Ein anderes Grundproblem sei, dass Menschen kurzfristigen Nutzen tendenziell höher bewerten als langfristige Vorteile (selbst wenn letztere deutlich größer sind). Vereinfacht gesagt: Testpersonen in Experimenten entscheiden sich eher dafür, sofort 100 Dollar zu erhalten als in einem Monat 101 Dollar - obwohl sie damit einen Zinssatz von zwölf Prozent realisieren würden, den sie bei keiner Bank bekämen. Auch wiegt für die meisten Menschen der Verlust von etwas, was sie besitzen, schwerer als ein hypothetischer Gewinn - selbst wenn letzterer größer wäre. Beide psychologischen Mechanismen - bekannt als Gegenwartspräferenz bzw. Verlust-Aversion - haben zur Folge, dass Menschen nur schwer dazu zu bewegen sind, heute auf kleine Annehmlichkeiten (ein luxuriöses Auto) zu verzichten - selbst wenn dies große Schäden in der Zukunft vermeidet (egal ob für sich selbst oder für andere Menschen).
Im Kern drängen die psychologischen Grundmuster Menschen vor allem in eine Richtung, die klimaorientiertes Handeln erschwert: Menschen schätzen Stabilität und scheuen Veränderungen. Sie meiden ungewohnte Handlungen. Ihnen ist wichtig, was ihr soziales Umfeld denkt, und sie haben Angst davor, etwas zu tun, was missbilligt werden könnte. "Normen zu folgen, die einen umweltfreundlichen Lebensstil fordern, fühlt sich bedrohlich an für Personen, deren Identität über Kreuz liegt mit 'Grün-Sein'", schreibt das Autorenteam. Konservative sind deshalb ziemlich schwer mit Klimaschutzkampagnen zu erreichen - weil das Thema als eines des politischen Gegners angesehen wird.
... und mögliche Gegenstrategien
Doch Sozialwissenschaftler können solche psychologischen Barrieren nicht nur identifizieren, so der Science-Aufsatz, sondern (in gewissem Maße) auch Gegenstrategien entwickeln. So mache es beispielsweise einen deutlichen Unterschied, mit welchen Worten ("wording") und in welchem Denkrahmen ("framing") über Klimawandel gesprochen werde. So sollte Energiesparen für Konservative weniger als Gebot des Klimaschutzes angepriesen werden, sondern eher als Gebot der Sparsamkeit (eine ur-konservative Tugend). Dem Gefühl von Distanz zum Problem der Erderwärmung könnte entgegengewirkt werden, würden in Kampagnen bereits heute und in direkter Nähe der Menschen auftretende Folgen thematisiert (statt wie so häufig das Schicksal von Eisbären in der Arktis irgendwann in der Zukunft). Und nachhaltiger Lebensstil könne dadurch attraktiver gemacht werden, dass man ihm mit kurzfristigem Nutzen verbindet.
Wegen des großen Einflusses, den das Umfeld auf Entscheidungen des Individuums hat, so der Aufsatz, sollten Umweltkampagnen nicht (nur) auf einzelne Menschen zielen, sondern auf kollektives Handeln und die Veränderung von Strukturen. Um Menschen zu politischem Engagement zu bewegen, bräuchten sie aber den Eindruck, sie seien nicht allein mit ihrem Anliegen (sonst setzt eine "Schweigespirale" ein). Außerdem hülfe es Menschen, wenn sie von der Notwendigkeit ihres Handelns überzeugt sind, wenn ein Erfolg möglich erscheint und wenn ihnen Lösungsmöglichkeiten für Probleme bekannt sind.
"Kampagnen scheitern, wenn sie nur auf Werte, Gefühle und Wissen zielen"
"Das Verhalten von Menschen wird durch Kräfte inner- wie auch außerhalb des Individuums bestimmt", lautet ein Fazit des Autorenteams. "Innere Faktoren wie Gefühle, Überzeugungen, Haltungen und Werte haben einen gewissen Einfluss, aber alles Verhalten findet in einem wirkmächtigen Kontext statt aus kulturellen Weltanschauungen, sozialen Netzwerken, Statusunterschieden, Politik, Routinen, Rollen und Regeln. Situationen bestimmen das Verhalten dermaßen stark, dass Kampagnen zum Scheitern verurteilt sind, wenn sie allein auf Werte, Gefühle oder Wissen zielen - und gewünschte Verhaltensänderungen nicht durch das soziale Umfeld eines Individuums und die es umgebende Infrastruktur befördert werden."
Dies heißt nicht, dass Kampagnen zur Verhaltensänderung nichts erreichen könnten – nur sollten sie halt, so das Plädoyer, auch die externen Faktoren im Blick haben. Ein "wirklich nachhaltiger Lebensstil" sei bei den gegenwärtig üblichen Strukturen in Industrieländern "für die meisten Individueen unattraktiv und unpraktisch, wenn nicht gar unmöglich". Massenhafte Verhaltensänderungen seien sogar noch schwieriger zu erreichen als individuelle.
Ein Hauptproblem von Umweltschutzkampagnen sei zudem, dass Menschen in der Regel nur das schützen, was sie kennen und wertschätzen - doch hätten die meisten heute kaum noch einen Bezug zur Natur. Studien zufolge machen es starke Naturerfahrungen während der Kindheit wahrscheinlicher, dass sich Menschen später als Erwachsene für die Umwelt einsetzen. Und so kommen die US-Psychologen ihn ihrem Aufsatz zu einem überraschenden Ratschlag: Wenn beispielsweise die Stadtplanung grüner würde und den Menschen wieder Kontakt zu Elementen von Natur ermöglichte (ein Großteil der Weltbevölkerung wohnt ja inzwischen in Städten), dann wäre das nicht nur gut für Gesundheit und Wohlbefinden - sondern würde sicherlich auch die Bereitschaft zum Schutz der Umwelt und die Empfänglichkeit für Klimaschutzkampagnen erhöhen.
Toralf Staud