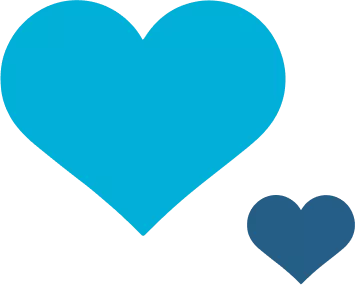Das Problem ist hinlänglich bekannt: Desinformationskampagnen aus politischen oder ökonomischen Interessen greifen um sich, Menschen informieren sich zunehmend aus ungeprüften Quellen, etwa über Soziale Netzwerke wie Facebook oder Twitter. "Umso wichtiger sind", schreiben Reinhard Hüttl und Volker Stollorz in der aktuellen Ausgabe der Wochenzeitung Die Zeit, "Wissenschaftler, die sich in Debatten vernehmbar einmischen, versachlichen und Fehldeutungen richtigstellen. Ebenso braucht es kompetente Journalisten, die wissenschaftliche Erkenntnisse einordnen, Hintergründe recherchieren - und Kollegen korrigieren, wenn sie einer Desinformation aufsitzen."
 Hüttl leitet das Helmholtz-GeoForschungszentrum auf dem Potsdamer Telegrafenberg und war Präsident der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften (Acatech), Stollorz studierte Biologie und Philosophie und hat in etlichen Zeitungen als Wissenschaftsredakteur gearbeitet. Derzeit leitet er das stiftungsfinanzierte Science Media Center in Köln, das Wissenschaftsinformationen gezielt für Journalisten aufbereitet.
Hüttl leitet das Helmholtz-GeoForschungszentrum auf dem Potsdamer Telegrafenberg und war Präsident der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften (Acatech), Stollorz studierte Biologie und Philosophie und hat in etlichen Zeitungen als Wissenschaftsredakteur gearbeitet. Derzeit leitet er das stiftungsfinanzierte Science Media Center in Köln, das Wissenschaftsinformationen gezielt für Journalisten aufbereitet.
Zwar mühten sich Medien, Wissenschaft und Politik bereits um eine bessere Wissenschaftskommunikation, räumen die beiden in ihrem ganzseitigen Zeit-Artikel ein: "Mittlerweile gibt es bundesweite Wissenschaftsjahre mit Bürgerdialogen und Ausstellungen, Hochschulen veranstalten Vorlesungen für Kinder, Universitäten lange Nächte der Wissenschaft, und viele größere Forschungsinstitute haben Pressesprecher und Marketingfachleute." Doch sei all das nicht genug. Vor allem aber sei im Gegenzug in den unabhängigen Medien die Wissenschaftskompetenz gesunken - wegen wirtschaftlicher Schwierigkeiten und anderer Prioritäten seien in zahlreichen Häusern die Wissenschaftsredaktionen verkleinert oder gar abgeschafft worden.
"Wissenschaft war noch niemals so bedeutsam wie heute"
Dabei sei Wissenschaft "noch niemals so bedeutsam wie heute" gewesen, so die beiden Autoren, und "fast jedes politische Thema hat eine wissenschaftliche Dimension". Mehr denn je brauche es daher "eine 'populäre, leicht zugängliche Version' von wissenschaftlichem Wissen". Doch hierfür genüge es nicht, wenn Wissenschaftler oder Institute selbst twittern wie der Raumfahrer Alexander Gerst als "Astro-Alex" mit mehr als einer Million Abonennten.
In ihrem Text machen Hüttl und Stollorz eine Reihe konkreter Vorschläge. Dies sind eher kleine Dinge, etwa die Forderung, die öffentlich-rechtlichen Medien sollten in ihren Nachrichtensendungen mehr Forschungsthemen aufgreifen. Und warum, fragen die beiden, sitzen eigentlich keine Wissenschaftler in den Rundfunkräten der öffentlich-rechtlichen Anstalten, wo doch so viele andere gesellschaftliche Gruppen dort Mandat und Stimme haben? Ihre Vorschläge betreffen aber auch den Wissenschaftsbetrieb selbst: Forscher, die sich öffentlich zu Wort melden und dabei nicht selten ins Kreuzfeuer geraten, sollten von Kollegen mehr Wertschätzung erhalten oder dies vielleicht auch bei Fachevaluationen angerechnet bekommen.
Hüttl und Stollorz fordern eine "Stiftung für Wissenschaftsjournalismus"
Hauptforderung von Hüttl und Stollorz ist aber die Gründung einer Stiftung für Wissenschaftsjournalismus. "Eine solche Institution könnte nicht nur die Aus- und Weiterbildung von Journalisten aller Ressorts fördern", schreiben sie. Sie könnte auch "neue journalistische Formen" ausprobieren oder Desinformation mittels automatischer Algorithmen auffinden und widerlegen. "Ihre Gelder könnten aus der öffentlichen Forschungsförderung und aus privaten Mitteln kommen. Natürlich darf die Unabhängigkeit des Journalismus dabei nicht gefährdet werden. Da das aber auch bei der öffentlichen Förderung der Wissenschaft gelingt, indem diese eigenständig über die Verwendung der Mittel entscheidet, sollte so ein Modell auch für den Journalismus taugen."
Sicher, all dies ist Zukunftsmusik. Aber zumindest der Bundespolitik scheint die Bedeutung der Wissenschaftskommunikation bewusst zu sein. Die neue Forschungsministerin Anja Karliczek (CDU) hat sie zu einem Hauptthema ihrer Amtszeit erklärt, just diese Woche lud sie zahlreiche Expertinnen und Experten zu einem Workshop nach Berlin. Ergebnisse gebe es noch nicht zu verkünden, hieß es aus der Ministeriumspressestelle dazu. Aber man arbeite intensiv daran.
tst