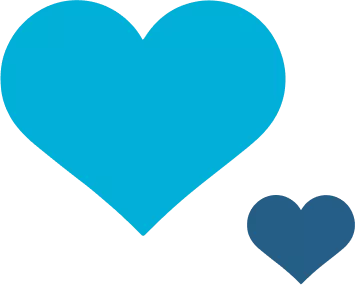Die Erde ist seit Beginn der Industrialisierung bereits um rund ein Grad (1,0 °C) wärmer geworden, und wenn die Emissionen nicht sofort drastisch sinken, ist eine Erhitzung um mehr als 1,5 °C praktisch unvermeidbar. Diese Aussage stammt aus einem Bericht des Weltklimarats IPCC - und das Gremium vermerkt dazu, dass das Vertrauen in diese Erkenntnis hoch sei.
Wissenschaftliche Expertisen werden von der Politik nachgefragt und oft zustimmend zitiert - jedoch häufig schleppend umgesetzt oder gar komplett übergangen. So legte die Bundesregierung im September einen Einstiegspreis von zehn Euro für eine Tonne Kohlendioxid-Emission fest, obwohl Klimaökonomen weit höhere Preise empfohlen hatten, damit die neue CO2-Bepreisung nicht wirkungslos bleibt. Aus Forschungserkenntnissen wird also nicht automatisch politisches Handeln. Ein Umstand, der wenig verwunderlich ist, wie die US-Wissenschaftshistorikerin Naomi Oreskes betont. Denn es sei nicht offensichtlich, warum man der Wissenschaft vertrauen sollte - sondern müsse der Öffentlichkeit erst einmal erklärt werden.
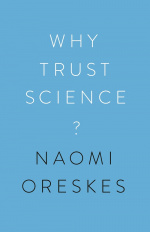 In ihrem neuen, bisher nur auf Englisch erschienenen Buch Why Trust Science? spitzt die bekannte Harvard-Professorin die Frage sogar zu: Warum sollten die Erkenntnisse der Klimaforschung verlässlicher sein als jene der Ölindustrie? Auf knapp 150 Seiten formuliert sie ihre Antwort. Oreskes forscht seit langem zu Widerständen gegen Klimaforschung und -politik – vor allem in den USA. Ihre Studie von 2004 über den wissenschaftlichen Konsens zum menschengemachten Klimawandel war eine der ersten zum Thema überhaupt, ihr Buch Merchants of Doubts über Desinformations-Strategien von Wirtschaftslobbyisten ist längst ein Klassiker. Es sei wichtig, den Forscherkonsens in der Klimakommunikation offensiv zu betonen, rät sie.
In ihrem neuen, bisher nur auf Englisch erschienenen Buch Why Trust Science? spitzt die bekannte Harvard-Professorin die Frage sogar zu: Warum sollten die Erkenntnisse der Klimaforschung verlässlicher sein als jene der Ölindustrie? Auf knapp 150 Seiten formuliert sie ihre Antwort. Oreskes forscht seit langem zu Widerständen gegen Klimaforschung und -politik – vor allem in den USA. Ihre Studie von 2004 über den wissenschaftlichen Konsens zum menschengemachten Klimawandel war eine der ersten zum Thema überhaupt, ihr Buch Merchants of Doubts über Desinformations-Strategien von Wirtschaftslobbyisten ist längst ein Klassiker. Es sei wichtig, den Forscherkonsens in der Klimakommunikation offensiv zu betonen, rät sie.
Ihr neues Buch, das auf einer Vortragsreihe beruht und entsprechend locker und diskussionsfreudig geschrieben ist, ist eine Reaktion auf die verbreitete und teils aggressive Wissenschaftsfeindlichkeit in den USA. Dort polarisieren nicht nur der Klimawandel, sondern zum Beispiel auch die Evolutionstheorie und das Impfen die Bevölkerung viel stärker als etwa in Deutschland. Allerdings zeigt das im November veröffentlichte Wissenschaftsbarometer, eine Umfrage der Initiative "Wissenschaft im Dialog", auch für Deutschland keine überwältigende Präferenz für eine wissenschaftsgeleitete Klimapolitik: Lediglich 54 Prozent sagen selbst in Zeiten von #FridaysForFuture, dass politische Entscheidungen auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen sollten - 34 Prozent zeigten sich unentschieden und zehn Prozent ablehnend. Und 50 Prozent finden, dass der Einfluss der Wissenschaft auf die Politik groß genug sei – vielleicht sogar zu groß. Die Frage, ob man der Klimaforschung vertraut, und wie ernst man ihre Empfehlungen nimmt, könnte also auch hierzulande von Interesse sein.
Gute Wissenschaft folgt allgemein anerkannten Methoden
In ihrem Buch geht Oreskes eine Reihe namhafter Wissenschaftstheoretiker des 20. Jahrhunderts durch: Karl Popper und Ludwig Fleck, Thomas Kuhn und Helen Longino, um nur einige zu nennen. Das ist kurzweilig zu lesen, denn sie bringt deren Argumente in wenigen Sätzen auf den Punkt. Doch die Diskussion bleibt auf einer abstrakten Ebene - meist geht es nicht um einzelne Forschungsdisziplinen oder konkrete Experimente, sondern um den wissenschaftlichen Fortschritt im Allgemeinen.
Der historische Rückblick beginnt mit der Einsicht, dass auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nur Menschen sind - also bestimmte Vorlieben und Interessen haben, die ihre Forschung beeinflussen könnten. Um sich vor Verzerrungen zu schützen, nutzen Wissenschaftler anerkannte Laborpraktiken und andere etablierte Methoden, um ihre Subjektivität zu eliminieren. Außerdem lassen sie ihre Arbeiten vor einer Veröffentlichung von Fachkollegen prüfen und kritisieren (das sogenannte "peer review"). Wenn sich dann in einem Fach ein Konsens zu einer bestimmten Frage herausschält, hat er also eine Menge kompetente Kritik überstanden - und darf deswegen als zuverlässig gelten.
In den letzten Jahren mündete die Methodik-Debatte in die Überzeugung, dass die gegenseitige fachliche Kritik noch besser funktioniert, wenn die wissenschaftliche Gemeinschaft vielfältig zusammengesetzt ist sowie Fachleute mit unterschiedlichen Perspektiven und Hintergründen umfasst. In diesen Fällen ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass unbeachtete Vorurteile und Verzerrungen aufgedeckt und korrigiert werden. Auch der Weltklimarat IPCC legt Wert auf die Diversität seiner Autorinnen und Autoren. Wenn er einem Ergebnis eine hohe Vertrauenswürdigkeit attestiert, stehen die Chancen also gut, dass es zuvor wirklich eingehend geprüft worden ist.
Sind Forschungsergebnisse aus der Industrie vertrauenswürdig?
Bei Ölfirmen sei das hingegen nicht so klar, warnt Naomi Oreskes. Denn was hier Forschungsergebnisse beeinflussen kann, seien weniger subjektive Sichten einzelner Wissenschaftler, sondern wirtschaftliche Interessen des Gesamtunternehmens - und die verschwänden auch nicht durch einen lebendigen Austausch innerhalb einer divers zusammengesetzten Belegschaft. "Aus dem Bereich der US-amerikanischen Industrie ist exzellente Forschung hervorgegangen", schreibt Oreskes, "aber von dort stammen auch Falschinformation, verfälschte Darstellungen und Ablenkungsversuche." Ihre praktische Empfehlung: Wenn sich die Fachleute einig sind und ihre Fachdisziplin so funktioniert, wie man es von guter Wissenschaft erwartet, dann sind die Erkenntnisse vertrauenswürdig.
Leider sagt Oreskes nicht, wer beurteilen soll, ob diese Voraussetzungen erfüllt sind. Zwar vermag man bisweilen selbst als Laie zu erkennen, ob ein Wissenschaftler private Interessen verfolgt und ob er auf Einwände sachlich und vernünftig reagiert. Häufig gehen auch wissenschaftliche Fachverbände und Universitäten Verdachtsfällen von Manipulation und Fälschung nach. Doch wer kann wirklich einschätzen, ob das Diskussionsklima in einer bestimmten Forschungsdisziplin offen ist? Journalisten kämen hier als unabhängige Kontrollinstanz infrage, doch die tauchen in dem Buch - leider - nirgends auf.
Einwände zum Konsens der Klimaforschung nur noch von Nicht-Fachleuten
Oreskes prüft ihre Kriterien dann an fünf Fallbeispielen (vor allem aus der Medizin), in denen Wissenschaft in die Irre ging. 1873 riet zum Beispiel der Arzt Edward H. Clarke von der Harvard Medical School Mädchen davon ab, zu lange zur Schule zu gehen. Mehr als vier oder fünf Stunden Lernen am Tag könne zur Unfruchtbarkeit führen, denn die vom Gehirn benötigte Energie fehle in den Eierstöcken und der Gebärmutter. Diese These wurde Ende des 19. Jahrhunderts in Medizinerkreisen weithin akzeptiert - obwohl sich Clarke nur auf die Untersuchung von sieben Patientinnen stützte. Und kaum jemand schien sich zu fragen, ob denn nicht auch Männern für irgendetwas die Energie fehlen könnte, wenn sie ihr Gehirn zu sehr benutzen ...
Solch einstiger "Konsens" zu einer abstrusen Theorie wirft die Frage auf: Müssen wir nicht selbst dann skeptisch bleiben, wenn sich die Wissenschaftler eines Fachs einig sind? Doch Oreskes weist darauf hin, dass zu Clarkes Thesen gar kein echter Konsens vorlag - denn Medizinerinnen wie Mary Putnam Jacobi von der Columbia University kritisierten schon damals Clarkes Methoden und Thesen mit Nachdruck, veröffentlichten auch eigene Studien. Die Situation ist also nicht mit dem heutigen Konsens der Klimaforscher über Grundfragen des Klimawandels vergleichbar - weil es zu diesem praktisch keinen Widerspruch mehr unter den tatsächlich im Fach forschenden Experten gibt.
Welche Rolle kann die Wissenschaft bei politischen Debatten spielen?
Fünf Wissenschaftler kommentieren die Thesen im Buch, darunter Ottmar Edenhofer und Martin Kowarsch vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) bzw. dem Berliner Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change (MCC). Sie stimmen Oreskes zu - fordern sie aber auf weiterzudenken: Es gehe in den aktuellen gesellschaftlichen Debatten zum Klimawandel ja nicht nur darum, ob Erkenntnissen der Klimaforschung vertraut werden kann - sondern es müsse auch um die besten Maßnahmen zum Klimaschutz gerungen werden. Hier könnten Klimaforscherinnen und Klimaforscher Optionen bewerten und Sachfragen klären: Sie "können dabei helfen, eine konstruktivere Diskussion der Stakeholder zu erleichtern", so Edenhofer und Kowarsch.
Daran hat Oreskes in ihrer Replik nichts auszusetzen. Uneinig sind sich beide Seiten jedoch in der Frage, wie denn eine politische Einigung in Klimafragen möglich wird. Oreskes setzt ihre Hoffnungen auf die Grundwerte, die über Kultur- und Religionsgrenzen hinweg geteilt werden: Den Tod von Menschen nicht billigend in Kauf zu nehmen, könne ihrer Ansicht nach ein Prinzip sein, auf dessen Grundlage über Klimaschutzmaßnahmen diskutiert werden kann. Edenhofer und Kowarsch genügt das nicht: Sie schlagen vor, dass Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit verschiedene Handlungsoptionen miteinander vergleichen, mit ihnen experimentieren und am Ende die Maßnahmen auswählen, die am besten funktionieren. An dieser Stelle werden die Leser entlassen, die Diskussion hat kein Fazit. Aber so ist das in der Forschung fast immer.
"Wissenschaftlicher Konsens ist selten", betont Oreskes. Umso bemerkenswerter seien die wenigen Fälle - etwa zum menschengemachten Klimawandel -, in denen er tatsächlich zustandekommt.
Alexander Mäder