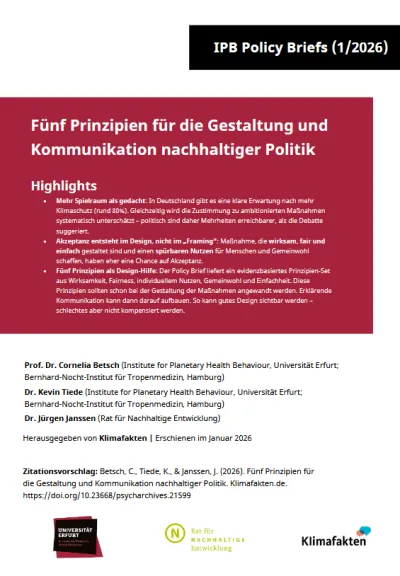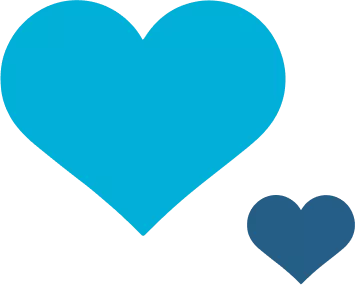Marcel Hänggi, 54, studierte Geschichte an der Universität Zürich, war von 1996 bis 2016 Journalist und Buchautor mit den Schwerpunkten Wissenschaft, Umwelt und Technik. Von 2016 bis Anfang 2022 unterrichtete er an – parallel zu seiner politischen Arbeit – an einem Gymnasium, 2022/23 arbeitete er dann vollberuflich als wissenschaftlicher Mitarbeiter des Vereins Klimaschutz Schweiz für die Gletscher-Initiative bzw. das Klimaschutzgesetz.
Marcel Hänggi, 54, studierte Geschichte an der Universität Zürich, war von 1996 bis 2016 Journalist und Buchautor mit den Schwerpunkten Wissenschaft, Umwelt und Technik. Von 2016 bis Anfang 2022 unterrichtete er an – parallel zu seiner politischen Arbeit – an einem Gymnasium, 2022/23 arbeitete er dann vollberuflich als wissenschaftlicher Mitarbeiter des Vereins Klimaschutz Schweiz für die Gletscher-Initiative bzw. das Klimaschutzgesetz.
Am 18. Juni 2023 hat die Schweiz ein neues Klimaschutzgesetz angenommen. Es legt fest, dass das Land ab spätestens 2050 treibhausgasneutral sein muss. Als erstes Land der Welt hat die Schweiz damit ein Netto-Null-Emissionsziel per Volksabstimmung gutgeheißen, nachdem zwei Jahre zuvor ein neues CO2-Gesetz an der Urne noch knapp durchgefallen war. Das neue Klimaschutzgesetz geht auf eine Volksinitiative, die so genannte Gletscher-Initiative, zurück und ist damit ein Erfolg der spezifisch schweizerischen Form der direkten Demokratie.
Gletscher-Initiative und Klimaschutzgesetz haben mich die letzten sieben Jahre zuerst neben- und schließlich vollberuflich beschäftigt. Nach erfolgreicher Abstimmung frage ich mich: Wie geeignet ist die direkte Demokratie, um Antworten auf eine existentielle Krise zu finden? Führt der Umstand, dass alle erwachsenen Bürgerinnen und Bürger gewisse Fragenper Volksabstimmung gemeinsam entscheiden, zu einer vertieften öffentlichen Auseinandersetzung mit dem Thema? Haben die Stimmbürger:innen informiert entschieden?
Die Antwort fällt gemischt aus.
Ausdruck des Misstrauens
Das politische System der Schweiz kennt zwei Typen von Volksabstimmungen: Bei Volksinitiativen wird, wie der Name sagt, eine Abstimmung aus der Bevölkerung angeregt; Referenden sind Abstimmungen über Gesetze, die das Parlament beschlossen hat. Eine Volksinitiative zielt auf eine Verfassungsänderung und ist immer Ausdruck eines Misstrauens: Die Initiator:innen (schweizerisch »Initiant:innen«) trauen Regierung und Parlament nicht zu, von sich aus das Richtige zu tun.
Ich war Ende 2015 als Journalist an der Klimakonferenz COP21 in Paris, als die für Umweltpolitik zuständige Bundesrätin (sprich: Ministerin) Doris Leuthard verkündete, die Schweiz setze sich für ein 1,5-Grad-Limit ein. Ich fragte sie, ob die Schweiz bereit sei, auch zu Hause eine so ambitionierte Politik zu verfolgen? »Ach«, antwortete sie: »Wir wären ja schon froh, wenn wir für 2 Grad auf Kurs wären. Und glauben Sie denn, die anderen Staaten meinen es ernst?«
Ich schrieb darauf in einem Kommentar für die Wochenzeitung WoZ: »Das Pariser Abkommen ist ein großes Versprechen. Jetzt gilt es, das Versprochene einzufordern.« Ein paar Wochen später dachte ich: Ich will nicht mehr nur schreiben, was es zu tun gilt. Ich will selber tun – und dazu kennt mein Land ein Instrument: die Volksinitiative.
Sieben Jahre
Ende 2016 erklärte sich Greenpeace bereit, den Aufbau einer Bewegung für eine klimapolitische Volksinitiative zu unterstützen. 2017 und 2018 formulierten wir den Text für die Gletscher-Initiative und gründeten den Verein Klimaschutz Schweiz.
Die wichtigsten Inhalte der Gletscher-Initiative lauteten:
-
Netto null Treibhausgasemissionen bis spätestens 2050;
-
ein Verbot fossiler Energieträger ab 2050.
2019 sammelten wir 113 000 Unterstützer-Unterschriften, die wir im November einreichten (100 000 sind nötig, damit eine Volksinitiative zustande kommt). Noch vor unserer Einreichung bekannte sich der Bundesrat, also die Schweizer Regierung, zu unserem Hauptziel: Klimaneutralität bis 2050.
Ende 2019 reichten die Initiator:innen der Gletscher-Initiative die gesammelten Unterschriften ein – deutlich mehr als eigentlich nötig waren; Foto: Flurin Bertschinger
Der Bundesrat ließ sich viel Zeit und übergab die Volksinitiative im Sommer 2021 dem Parlament. In einer begleitenden Mitteilung (»Botschaft«) ans Parlament bekannte er sich erneut zum Netto-Null-Ziel, lehnte aber das Fossilenergieverbot ab. Er schien (wie so viele) daran zu glauben, dass es möglich und sinnvoll sein könnte, weiterhin fossilen Kohlenstoff zu verbrennen und das dabei anfallende CO2 irgendwie wegzuzaubern.
Die Fachleute, die die bundesrätliche Stellungnahme verfassen, wissen es natürlich besser, und deshalb ist diese Botschaft ein interessantes Dokument. Man merkt ihr an, dass seine Autor:innen die Gletscher-Initiative überzeugend fanden; manche Passagen haben sie wörtlich aus unseren Erläuterungen zur Initiative übernommen – um dann doch dagegen zu argumentieren.
Kurz bevor der Bundesrat das Thema dem Parlament übergab, scheiterte ein anderes klimapolitisches Gesetz: Das CO2-Gesetz, das Maßnahmen zur Emissionssenkung bis 2030 vorsah, fiel in der Volksabstimmung vom 13. Juni 2021 knapp durch. Dem Parlament bot sich die Gletscher-Initiative nun als Ausweg aus der Sackgasse nach dem Nein zum CO2-Gesetz an. Es hieß freilich nicht die Gletscher-Initiative gut, sondern erarbeitete ein eigenes Gesetz als sogenannten Gegenvorschlag. Mit einem Gegenvorschlag hofft das Parlament, Initiator:innen zum Rückzug ihrer Volksinitiative zu bewegen.
Gegenwind von rechtsaußen
Wer eine Volksinitiative lanciert, hat von Gesetzes wegen nur zwei Aufgaben: Er formuliert den Text und sammelt die Unterschriften. Die politische Realität ist komplexer: Mit einem Gegenvorschlag macht das Parlament ein Verhandlungsangebot. Als Gesetz ist dieser Gegenvorschlag konkreter, als es eine Volksinitiative sein kann, die auf eine Verfassungsänderung abzielt. Das kann einen Rückzug für die Initiator:innen also interessant machen.
Das vom Parlament erarbeitete Klimaschutzgesetz übernahm denn auch die wichtigsten Forderungen der Gletscher-Initiative und enthielt darüber hinaus Maßnahmen im Bereich der Technologiepolitik (Innovationsförderung und Unterstützung von Unternehmen, die sich verbindliche Netto-Null-Fahrpläne geben) sowie der Gebäude (finanzielle Förderung von Heizungsersatz und Energieeffizienz). Zudem verpflichtet es den Bundesrat, dem Parlament regelmäßig Beschlussempfehlungen für weitere Maßnahmen vorzulegen. Das Gesetz enthielt zwar wiederum kein Verbot fossiler Energie, immerhin aber doch ein klares Bekenntnis zum Ausstieg: Die Emissionsziele müssen nämlich durch Emissionssenkungen im Inland erreicht werden, soweit es »möglich und wirtschaftlich tragbar« ist. Weil der Ersatz fossiler Energien tatsächlich möglich und wirtschaftlich tragbar ist, muss diese Bestimmung in ihrer Wirkung einem Fossilenergieverbot gleichkommen. Wir erachteten das Gesetz deshalb als befriedigend und zogen die Gletscher-Initiative somit zurück.
»Mir kam es mitunter vor, als lebte ich in zwei Welten: Hier der alarmierende Stand des wissenschaftlich fundierten Wissens über die Klimakrise; da das Klein-Klein des Abstimmungskampfs und eine politische Kampagne, die niemanden verschrecken will«
Nun machte aber die Rechtsaußenpartei SVP ebenfalls von einem direktdemokratischen Instrument Gebrauch und sammelte Unterschriften, um eine Volksabstimmung über das Klimaschutzgesetz zu erwirken, für das sonst der Parlamentsbeschluss genügt hätte. Der Rest ist schnell berichtet: Es kam zu einer Volksabstimmung, der SVP-Vorstoß scheiterte klar, und das als Reaktion auf die Gletscher-Initiative verabschiedete Klimaschutzgesetz hatte Bestand. Dass die Schweiz somit als erstes Land die Klimaneutralität per Volksentscheid bekräftigt hat, verdanken wir also der Anti-Klima-Lobby!
Es gab noch eine weitere Ironie bei der Sache: Treibende Kraft beim Thema innerhalb der SVP war der Nationalrat (Parlamentarier), Erdöl- und Autolobbyist Albert Rösti. Kurz nachdem seine Partei begonnen hatte, Unterschriften gegen das Gesetz zu sammeln, wurde er in die Regierung gewählt und übernahm das Umwelt- und Energiedossier. Nun musste er als Bundesrat das Gesetz im Abstimmungskampf vertreten, das er als Nationalrat bekämpft hatte.
Bewegungsaufbau, Wissenschaft und Politik beim Lunch, Mobilisierung
Auf dem langen Weg von der Pariser Klimakonferenz bis zur Abstimmung im Sommer 2023 änderte sich auch unsere Rolle: Zu Beginn stand der Aufbau einer Bewegung im Zentrum. Tausende haben sich in der einen oder anderen Form zunächst für die Gletscher-Initiative und dann für das Klimaschutzgesetz engagiert. Politiker:innen waren in dieser Phase nicht so wichtig, aber schon zu diesem Zeitpunkt sicherten wir uns die Unterstützung von einzelnen Abegordneten aus jeder großen Partei mit Ausnahme der SVP.
Das zivilgesellschaftliche Engagement war ein wichtiger Grund, weshalb das Gesetz schließlich eine klare Mehrheit fand. Das CO2-Gesetz wurde 2021 von einer ebenso breiten Allianz unterstützt wie nun das Klimaschutzgesetz, war aber eine Vorlage des Parlaments, die nicht von einer Bewegung mit Begeisterung getragen wurde. Auch in der parlamentarischen Phase war die Bewegung wichtig: Nur wer glaubhaft machen kann, in einer Volksabstimmung gewinnen zu können, kann Druck auf das Parlament ausüben.
In der Phase der Erarbeitung des Gesetzes kommt den Initiator:innen einer Volksinitiative offiziell keine Rolle zu. Tatsächlich arbeiteten wir aber am Gesetzesentwurf mit, indem wir in einer Art Pendeldiplomatie zwischen Wissenschaft und Politik vermittelten. Es begann damit, dass ich ein Mittagessen zwischen einem Parlamentarier der FDP (die ideologisch viel offener ist als die deutsche FDP) und einem Professor für Klimapolitik arrangierte. Die Frage, wie man wissenschaftliches Wissen in die politische Entscheidungsfindung einbringt, wird unter Wissenschafter:innen oft mit großer Frustration diskutiert. Meine Erfahrung war, dass eine Vertrauensbeziehung zwischen einem Wissenschaftler und einem einflussreichen Politiker mehr bringt als Vorträge und Studien. Bald kamen ein zweiter Wissenschaftler und ein zweiter, grüner Parlamentarier hinzu; mit einem linken und einem bürgerlichen Parlamentarier an der Seite konnten wir schon bald eine große Zahl weiterer Politiker:innen für unsere Sache gewinnen. Die Zahl der Personen, die aktiv an der Formulierung des Gesetzes mitwirkten, blieb aber klein.

Schon der Name war wichtig: Die "Gletscher-Initiative" nutzte das in der Schweiz wohl sichtbarstes Symbol der Klimakrise; Foto: Screenshot gletscher-initiative.ch
In der Phase des Abstimmungskampfs schließlich, die im März 2023 begann, leiteten wir die Kampagne. Unsere Geschäftsstelle hatte bisher sieben Mitarbeitende umfasst; nun erhöhten wir auf siebzehn. Der Abstimmungskampf kostete etwas über viereinhalb Millionen Franken – exklusive der Ausgaben, die Partnerorganisationen ihrerseits für eigene Inserate und Personalkosten ausgaben. Das Geld kam von Stiftungen, Verbänden und aus Privatspenden.Wir wurden von allen großen Parteien außer der SVP unterstützt. Auch die meisten Wirtschaftsverbände standen auf unserer Seite, und die Umweltorganisationen unterstützten uns aktiv.
Es ging darum, eine Mehrheit zu überzeugen. Links hatten wir auf sicher, ganz rechts war nichts zu gewinnen – es ging also darum, die Mitte bis möglichst weit nach Mitte-Rechts zu überzeugen. Noch wichtiger aber als zu überzeugen, war es, zu mobilisieren. Dass das CO2-Gesetz 2021 abgelehnt worden war, hatte ja auch daran gelegen, dass sich sehr konservative, gegenüber Klimaschutz sehr kritisch eingestellte Wähler:innen damals überdurchschnittlich stark an der Abstimmung beteiligt hatten. Diesmal nun mobilisierten wir besser als die Gegenseite, wie die Nachwahlbefragung zeigt, wobei wir links erfolgreicher mobilisierten als in der politischen Mitte.
Mehrheitsfähigkeit erreichen: Bergwanderungen und Bullshit-Bingo
Hat sich nun die Volksinitiative als tauglich erwiesen, Antworten in der existentiellen Klimakrise zu finden?
Wir haben dazu beigetragen, den Diskurs zu verschieben, und eine einst als extrem wahrgenommene Forderung – das Bekenntnis zum Ausstieg aus der fossilen Energie – mehrheitsfähig gemacht. Als 2018 erstmals eine Zeitung über unser Projekt berichtete, bezeichnete der Wirtschafts-Dachverband unser Anliegen als »brandgefährlich« – im Abstimmungskampf war er dann einer unserer Partner. Dass die CO2-Emissionen nicht lediglich sinken, sondern (netto) null erreichen müssen, um eine weitere Erderwärmung zu verhindern, war 2018 noch kaum im Bewusstsein der Öffentlichkeit; als dann 2021 die parlamentarischen Beratungen begannen, stellte mit Ausnahme der Klimaleugner ganz rechts niemand mehr dieses Ziel in Frage.
Geholfen haben bei dieser Diskursverschiebung weitere Faktoren: die großen Klimastreik-Demonstrationen von 2019, der 1,5-Grad-Spezialbericht des IPCC von 2018 und der Umstand, dass sich seit 2018 zahlreiche Regierungen weltweit zur Klimaneutralität bekannt haben.

Mit Wanderungen in die Berge und, genau, zu Gletschern mobilisierte die Kampagne für strengeren Klimaschutz; Foto: Florian Wüstholz
Als hilfreich hat sich auch der Name »Gletscher-Initiative« erwiesen. Es gelang uns, die Gletscherschmelze als sichtbarstes Symbol der Klimakrise zu nutzen. Gletscher kann man, anders als das Klima, fotografieren, und fast jeder Medienbeitrag zur Initiative wurde mit Gletscherbildern illustriert. Wir gründeten Komitees, um bestimmte Bevölkerungsgruppen anzusprechen, beispielsweise ein Landwirtschaftskomitee; und anders als bei der verlorenen Volksabstimmung zum CO2-Gesetz 2021 gab es diesmal beim Ergebnis keinen Graben zwischen zustimmender Stadt- und ablehnender Landbevölkerung. Wir verteilten 20.000 Fahnen in vier Sprachen, die im ganzen Land von den Balkonen hingen. Ein Textilhersteller lieferte uns zum Selbstkostenpreis Socken in den Gletscher-Initiative-Farben. Bei Parlamentsdebatten spielten wir Bullshit-Bingo. Wir organisierten Wanderungen im ganzen Land und eine Abschiedszeremonie für den verschwundenen Pizolgletscher (der ein internationales Medienecho auslöste, das uns verblüffte). Mit der Gletscher-Initiative hatten wir eine Marke geschaffen – ja, Politik ist auch Marketing.
Konstruktive Gesetzesarbeit
In der parlamentarischen Phase ist es uns gelungen, Erkenntnisse aus der sozialwissenschaftlichen Forschung in den politischen Prozess einzuspeisen. In dieser Forschung hat in den letzten Jahren ein Paradigmenwechsel stattgefunden, weg vom hoch abstrakten, jenseits von Ökonomenzirkeln wenig Begeisterung auslösenden CO2-Preis als Allheilmittel, hin zu aktiver Technologiepolitik. Das neue Klimaschutzgesetz reflektiert diesen Paradigmenwechsel ebenso wie etwa der Inflation Reduction Act der USA.
Kaum gelungen ist es uns aber, den Gedanken einzubringen, der am Ursprung der Gletscher-Initiative stand. Als Journalist und Buchautor habe ich immer wieder festgestellt, dass in der Klimapolitik vor allem darum gestritten wird, was es mehr braucht: mehr Erneuerbare, mehr Energieeffizienz, mehr »Kompensationen« …, wo es doch in erster Linie um das Weniger gehen müsste: weniger Treibhausgasemissionen, weniger fossile Energie (respektive so bald als möglich gar keine mehr). Fördert man die Erneuerbaren, ohne gleichzeitig die Fossilen zurückzubinden, riskiert man, dass jene zusätzlich zu diesen verbraucht.
»Selbst positive Erfahrungen wie etwa das Glühbirnenverbot und die dadurch beförderten Innovationen der LED-Technik vermochten viele Politiker:innen nicht dazu zu bringen, 'Verbot' und 'Innovation' zusammenzudenken«
Deshalb war das Fossilenergieverbot ab 2050 eine unserer zentralen Forderungen: Nur der Kohlenstoff, der gar nie in Verkehr gesetzt wird, gelangt sicher auch nie als CO2 in die Atmosphäre. Doch der Begriff »Verbot« löst bei vielen liberalen Politiker:innen Abwehr aus (als könnte es Freiheit ohne Verbote geben). Selbst positive Erfahrungen wie etwa das Glühbirnenverbot und die dadurch beförderten Innovationen der LED-Technik vermochten viele Politiker:innen nicht dazu zu bringen, »Verbot« und »Innovation« zusammenzudenken.
Der Gegenvorschlag des Parlaments verzichtet denn auch auf ein explizites Verbot. Dass wir trotzdem bereit waren, die Volksinitiative zurückzuziehen, hat mit einer ernüchternden Erkenntnis zu tun: Selbst eine glasklare Verfassungsbestimmung garantiert nicht ihre Umsetzung. 1994 hatte eine erfolgreiche Volksinitiative beispielsweise den schönen Satz in die Verfassung geschrieben: »Der alpenquerende Gütertransitverkehr von Grenze zu Grenze erfolgt auf der Schiene«. Trotzdem sind alpenquerende Lastwagenfahrten gesetzlich nach wie vor vorgesehen. Weil die Schweiz kein Verfassungsgericht kennt, können Verfassungsbestimmungen nicht eingeklagt werden.
Doch bei aller Unschärfe: Im Kern ist das Klimaschutzgesetz ein Bekenntnis zum Ausstieg aus den fossilen Energien. Wenn man es richtig auslegt, wird das Gesetz unserer Kernidee – dass es um das Weniger gehen muss – gerecht.
Ernüchterungen
Als schwierig, mitunter frustrierend erlebte ich schließlich den Abstimmungskampf. Gestritten wurde, wieder einmal, um das Mehr: darum, wo denn der Strom herkomme, den man mit der Dekarbonisierung des Energiesystems und beispielsweise den Wechsel zu E-Heizungen zusätzlich braucht, und was das alles koste! Mit dem russischen Überfall auf die Ukraine wurde die problematische Abhängigkeit von fossilen Energierohstoffen zwar für kurze Zeit Medienthema, aber die Angst vor einer Energiekrise verdrängte diese Einsicht bald wieder aus der Berichterstattung und wurde von der Gegenseite auf ihre Weise bewirtschaftet.
Der Abstimmungskampf brachte manche Ernüchterung:
-
Obwohl die Klimaneutralität 2050 natürlich zu wenig ambitioniert ist und das Gesetz (außer hoffentlich der Fossilenergiewirtschaft) niemandem »wehtut«, haben es doch 41 Prozent der Abstimmenden abgelehnt. Und 57 Prozent der Stimmberechtigten fanden das Thema nicht wichtig genug, um überhaupt abzustimmen.
-
Unsere Gegnerin, die SVP, fuhr eine massive Desinformationskampagne. Sie basierte ihre ganze Argumentation auf Zahlen zu angeblichen Kosten der Energiewende aus zwei wissenschaftlichen Studien, die sie falsch interpretierte. Und sie wiederholte diese falsche Interpretation auch dann noch unbeirrt, als sich die Urheber der Studien davon ausdrücklich distanzierten. Wir konnten die falschen Behauptungen nur aufdecken und hoffen, gehört zu werden. Immerhin: Am Ende habe die SVP übertrieben und ihre Glaubwürdigkeit verspielt, meint ein bekannter Politologe. Vielleicht hat uns die schrille Gegnerschaft also sogar geholfen.
-
Komplexe Botschaften ließen sich kaum vermitteln. Schon dass mit der Energiewende der Strombedarf zu-, der Gesamtenergiebedarf aber abnehmen wird, war schwierig verständlich zu machen. Viele Leute (und auch Journalist:innen) haben offenbar Mühe, zwischen Energie und Strom zu unterscheiden und zu verstehen: Im fossilen System verpufft ein Großteil der eingesetzten Primärenergie in ineffizienten Kraftwerken oder Verbrennungsmotoren; bei der Elektrifizierung der Wirtschaft und zum Beispiel auch des Verkehrs wird zwar mehr Strom verbraucht, wegen des Wegfalls fossiler Rohstoffe und deren ineffizienter Verstromung aber insgesamt weniger (Primär)Energie. Die Schwierigkeit, scheinbar paradoxe Aussagen zu vermitteln, war auch dem CO2-Gesetz 2021 zum Verhängnis geworden: Es sah eine Erhöhung der CO2-Abgabe vor – von der die Mehrheit der Bevölkerung unterm Strich aber profitiert hätte, weil das mit der Abgabe erhobene Geld zum größeren Teil an die Bevölkerung zurückfließt. Diesen Mechanismus hatten, wie Nachwahlbefragungen zeigten, die meisten nicht verstanden.

Ein Grund für den Erfolg der Schweizer Klimacampaigner: Sie mobilsierten ganz bewusst auch in ländlichen Regionen und jenseits des linken Milieus; Foto: Screenshot gletscher-initiative.ch
- Als Journalist und Buchautor versuchte ich immer, Denkmuster (Frames) zu durchbrechen. In einem Abstimmungskampf geht das nicht. Wenn die SVP Panik vor einer katastrophalen »Stromlücke« schürt, muss man beschwichtigen und kann nicht gut fragen: Ginge es uns nicht vielleicht sogar besser, wenn weniger Energie auf dem Markt wäre? Eine Reduktion des Energieverbrauchs kann zwar durchaus mehrheitsfähig sein: Vor rund 15 Jahren bekannten sich zahlreiche Gemeinden und Kantone in der Schweiz zur so genannten 2000-Watt-Gesellschaft, also dem Ziel, den kontinuierlichen Gesamtenergieverbrauch pro Person von heute 5000 auf 2000 Watt zu senken. Doch damals herrschte keine energiepolitische Verunsicherung wie heute, und auf nationaler Ebene hätte es diese Forderung auch damals schwer gehabt.
-
Themen, die im Zusammenhang mit der Klimakrise wichtig wären, blieben in der Debatte außen vor; auch wir pushten sie nicht: Alles, was wir sagten, musste für unsere breite Koalition von links bis mitte-rechts akzeptabel sein. Klimagerechtigkeit, Suffizienz oder gar die Notwendigkeit systemischer Veränderungen waren deshalb kein Thema, solche Begriffe wirken außerhalb des linken oder alternativen Milieus (leider) abschreckend. Manche unserer Partner betonten sehr, dass das Klimaschutzgesetz auf Verbote verzichtet. Dass Verbote gerade sinnvoll sein können, sagte (fast) niemand.
-
Mit unserer auf Mehrheitsgewinnung ausgerichteten Kommunikation trugen wir nolens volens zum Glauben bei, das Netto-Null-Ziel 2050 genüge, und mit dem Klimaschutzgesetz hätte die Schweiz ihre Schuldigkeit getan. Das ist bekanntlich nicht der Fall: Laut dem letzten IPCC-Bericht müssen die Emissionen weltweit spätestens 2050 netto null erreichen, und die Schweiz als reiches Land wäre aufgrund des Pariser Übereinkommens verpflichtet, »voranzugehen«, also deutlich schneller zu sein. Mir kam es mitunter vor, als lebte ich in zwei Welten: Hier der alarmierende Stand des wissenschaftlich fundierten Wissens über die Klimakrise; da das Klein-Klein des Abstimmungskampfs und eine politische Kampagne, die niemanden verschrecken will.
-
Die Medien berichteten mehrheitlich wohlwollend über das Klimaschutzgesetz. Dass die konservative Neue Zürcher Zeitung (NZZ) eine Kampagne dagegen führte, die mitunter in Realsatire kippte – geschenkt. Dafür hat die Schweiz mit dem Blick ein ziemlich gut gemachtes Boulevardmedium. Nicht auszudenken, wie die Debatte gelaufen wäre, wäre der Blick wie die Bild in Deutschland! Allerdings berichteten die Medien in dem von der SVP gesetzten Frame: Man behandelte das Gesetz als Energie- statt als Klimavorlage. Man sprach über die angeblich drohende »Stromlücke« (elektrische Installationen lösten die Gletscher als typische Illustration der Medienbeiträge ab) statt über die Abhängigkeit von fossiler Energie. Und vor allem sprach man über Kosten – die (angeblichen) Folgekosten des Gesetzes, nicht aber die Kosten des Status quo: ein Muster, das seit den 1990er-Jahren von erdölindustrienahen Ökonomen gefördert wird. Das Festhalten am Frame »Klimaschutz kostet« führte bis zum Selbstwiderspruch. So schrieb eine Zeitung von einer »Belastung« der Wirtschaft, während sie doch Studien referierte, die zeigen, dass die Energiewende die Wirtschaft entlastet. So ging die Strategie der SVP trotz aller Faktenchecks letztlich zumindest teilweise auf.
-
Und schließlich: Es gibt keine Garantie, dass die Ziele des Gesetzes in der Realität erreicht werden. Jeder weitere Schritt muss wieder den gesamten politischen Prozess durchlaufen, und der zuständige Bundesrat (Minister) ist im Moment ein ehemaliger Anti-Klima-Lobbyist. Das Klimaschutzgesetz schreibt in erster Linie abstrakte Ziele vor; sobald es um konkrete Maßnahmen geht, gibt es auch mehr Gegner:innen, die für sich den einen oder anderen Nachteil befürchten.
Echte Debatten ermöglichen
Das Fazit meines Engagement für Gletscher-Initiative und Klimaschutzgesetz ist ambivalent. Die Volksinitiative ermöglichte es uns, Druck zu machen, ein politisches Anliegen voranzubringen und direkt im Gesetzgebungsprozess mitzuwirken. Wir konnten wissenschaftliche Erkenntnisse einbringen und Mehrheitsverhältnisse verschieben. Dass ich, der ich nie Träger eines Amts oder Mitglied einer Partei war, diesen Prozess anstoßen konnte und man mich ernstnahm, einfach weil ich etwas von der Sache verstand, ist natürlich ein schönes Gefühl.
Aber was, wenn Maßnahmen nötig werden, die wirklich kosten? Viele sagten nach der Abstimmung, es brauche nun Klimaschutz-Maßnahmen, die »schmerzen«. Ich halte nichts von dieser Formulierung, denn sie lässt außer Acht, wie viele Menschen bereits heute unter dem fossilenergiebasierten Status quo leiden. Aber richtig ist, dass es weitergehende Maßnahmen brauchen wird. Wie findet man Mehrheiten dafür? Es ist wissenschaftlicher Konsens, dass es »in ihrem Ausmaß beispiellose Systemveränderungen« braucht, um die Klimaerhitzung zu begrenzen. Natürlich hüteten wir uns im Abstimmungskampf, genau davon zu sprechen. Früher oder später wird aber nichts an der Erkenntnis vorbeiführen, dass wir im Globalen Norden seit langem mehr Ressourcen verbrauchen, als uns zustehen. Wie lässt sich eine solche Erkenntnis demokratisch verhandeln?
Blick in die Nachbarländer
Die Erfahrung mit der Gletscher-Initiative lässt sich nur bedingt auf die Schweizer Nachbarn Deutschland und Österreich mit ihren anderen politischen Kulturen übertragen, aber gewisse Ähnlichkeiten sind dennoch auffällig. Natürlich kann ein klimapolitisches Anliegen an der Wahlurne stets scheitern, wie 2021 in der Schweiz oder im März 2023 der Volksentscheid »Berlin 2030 klimaneutral«. Und Volksentscheide können erfolgreich sein, aber danach nicht oder nur unvollständig umgesetzt werden. In Österreich war 2020 das Klimavolksbegehren erfolgreich, in Bayern 2019 das Volksbegehren Artenvielfalt. In beiden Fällen handelten Regierung und Parlament nach erfolgreichem Volksbegehren und erließen Gesetze, im Ergebnis gab es weder in Österreich noch Bayern eine Volksabstimmung.
»Früher oder später wird aber nichts an der Erkenntnis vorbeiführen, dass wir im Globalen Norden seit langem mehr Ressourcen verbrauchen, als uns zustehen. Wie lässt sich eine solche Erkenntnis demokratisch verhandeln?«
In Bayern seien zwar, sagt Franziska Wenger, die Referentin für das Volksbegehren beim Landesbund für Vogel- und Naturschutz Bayern, seit der Anpassung des Naturschutzgesetzes neue Stellen geschaffen, Agrarumweltmaßnahmen verbessert und neue Naturwälder ausgewiesen worden. Bezüglich der Reduktion des Pestizideinsatzes oder der Etablierung eines Biotopverbunds hingegen habe man wenig erreicht, und jetzt vor den Landtagswahlen erstarke die gegnerische Lobby, und die Anstrengungen der Regierung erlahmten.
In Österreich hat sich die Regierung aus ÖVP und Grünen die Forderungen des erfolgreichen Klimavolksbegehrens zu eigen gemacht und etwa eine CO2-Bepreisung eingeführt – aber »viel zu lasch«, sagt die Sprecherin des Volksbegehrens Andrea Dierer. Und seither habe die große Koalitionspartnerin, die ÖVP, eine 180-Grad-Wende vollzogen. Die Verlängerung des österreichischen Klimaschutzgesetzes, die nach dem Volksbegehren in die Wege geleitet wurde und Emissionsbudgets und Maßnahmen vorsähe, werde heute von der ÖVP im Verbund mit Wirtschaftsverbänden blockiert.
Demokratie erweitern
Diese Erfahrungen aus allen drei Nachbarländern zeigen: Ein Abstimmungskampf ist keine offene Diskussion, in der sich die besten Argumente durchsetzen. Und es müsste möglich sein, demokratische Formen zu finden, die adäquate Antworten auf existentielle Krisen in wirklichen Debatten finden. Einen Hinweis, in welche Richtung das gehen könnte, liefert ausgerechnet eine sehr archaische Form direkter Demokratie.
Im konservativen Bergkanton Glarus haben weder 2021 das CO2-Gesetz noch 2023 das Klimaschutzgesetz eine Mehrheit gefunden. Zwischen den beiden Abstimmungen hat sich der Kanton aber eines der progressivsten Energiegesetze der Schweiz gegeben, samt Öl- und Gasheizungsverbot. Wie war das möglich?
Während man in Glarus wie überall sonst an der Wahlurne über nationale Vorlagen abstimmt, werden kantonale Vorlagen an der so genannten Landsgemeinde auf dem Dorfplatz des Hauptorts verhandelt. Hier entstehen ganz andere Dynamiken als bei einer Urnenabstimmung. Während man sich in der Urnendemokratie jeder Diskussion und jedem Argument verschließen kann, um am Ende doch »Nein« auf den Zettel zu schreiben, weil man jede Veränderung ablehnt, muss man muss sich in der Landsgemeinde-Demokratie persönlich auf den Dorfplatz begeben und den Redebeiträgen zuhören. Das ermöglicht immer wieder Entscheide außerhalb dessen, was im normalen Politgeschäft drinliegt.

Großer Jubel bei der Kampagne, als am 18. Juni 2023 der Vorschlag zu einem neuen Klimaschutzgesetz von den Schweizer Stimmbürgern mit deutlicher Mehrheit angenommen wurde; Foto: Niklas Eschenmoser
In einer Demokratie müssen alle mitbestimmen können, die das wollen. Wer von einer Sache, über die zu entscheiden ist, nichts versteht, hat ein Anrecht darauf, dass man es ihr oder ihm erklärt. Aber warum sollen auch Bürger:innen mitentscheiden, die gar nicht verstehen wollen? Die Landsgemeinde verlangt ein minimales Engagement jedes und jeder einzelnen.
Eine modernere Form demokratischer Entscheidungsfindung, die echte Debatten ermöglicht, sind die Bürger:innenräte mit im Losverfahren repräsentativ aus der Gesamtbevölkerung ausgewählten Mitgliedern. Solche Räte heißen nach eingehendem Studium der Sache auch Vorschläge gut, die im normalen Politbetrieb keine Chance hätten. Teilnehmer:innen erleben solche Bürger:innenräte als bereichernd. Freilich: Ob sich ein solcher Rat wie der Bürgerrat Klima in Deutschland als Initiative der Zivilgesellschaft bildet, ob er wie der Klimarat in Österreich aufgrund eines Volksbegehrens von der Regierung eingesetzt wird, oder ob ein unter Druck geratener Präsident ihn einsetzt wie die Convention citoyenne pour le climatin Frankreich: Umgesetzt wurde in all diesen Fällen nur der kleinste Teil der Forderungen.
Der Demokratieaktivist Percy Vogel, Vorstand des Trägervereins des deutschen Bürgerrats Klima, sagt, Bürger:innenräte müssten mit Volksabstimmungen gekoppelt werden, deren Beschlüsse rechtlich verbindlich sind. Vor übertriebenen Erwartungen warnt er: »Um die Gesellschaft systemisch zu verändern, müssen wir gleichzeitig auch die Demokratie verbessern, und beides braucht Zeit, die wir immer weniger haben.« Darauf zu setzen, dass die bloße Veranstaltung unverbindlicher Bürgerräte eine klimapolitische Transformation bewirken könne, hält er für naiv: »Schließlich geht es um Machtverhältnisse, und die wurden wohl noch nie durch Bürgerbeteiligung allein verändert.«