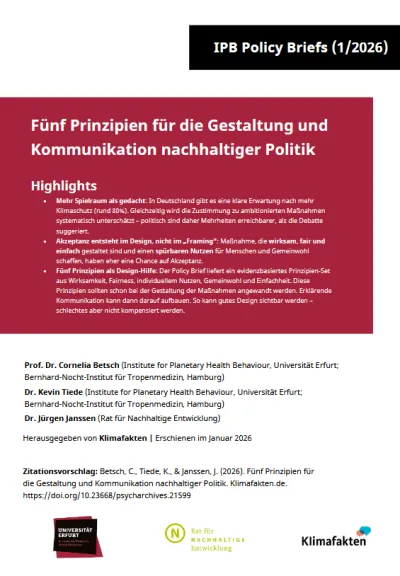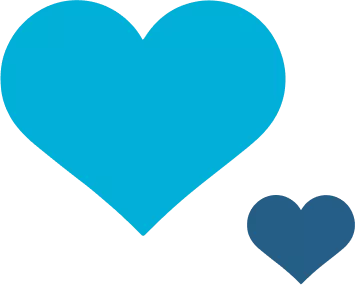Elmar Große Ruse ist freiberuflicher Experte für Klimaschutz, Umweltpsychologie, Klimakommunikation und Gesellschaftliche Transformation. Er hat Umweltpsychologie mit Fokus auf Umweltökonomie und Organisationspsychologie in Bonn, Edinburgh und Bochum studiert. Er war unter anderem tätig bei der Naturfreundejugend Deutschlands, der Grünen-Bundestagsfraktion und dem Naturschutzbund (NABU), von 2012 bis 2022 arbeitete er beim WWF Schweiz im Bereich Klimaschutz und Energiepolitik.
Elmar Große Ruse ist freiberuflicher Experte für Klimaschutz, Umweltpsychologie, Klimakommunikation und Gesellschaftliche Transformation. Er hat Umweltpsychologie mit Fokus auf Umweltökonomie und Organisationspsychologie in Bonn, Edinburgh und Bochum studiert. Er war unter anderem tätig bei der Naturfreundejugend Deutschlands, der Grünen-Bundestagsfraktion und dem Naturschutzbund (NABU), von 2012 bis 2022 arbeitete er beim WWF Schweiz im Bereich Klimaschutz und Energiepolitik.
„Shit Storm“ würde man heute das nennen, was 1998 über Bündnis 90/Die Grünen hereinbrach, nachdem sie ihr Programm für die damalige Bundestagswahl beschlossen hatten: Der Liter Benzin müsse rund 5 DM (ca. 2,55 €) kosten, damit der Preis die ökologische Kostenwahrheit widerspiegelt und eine Lenkungswirkung hin zu weniger Autoverkehr verursacht. Angesichts der markanten Differenz zum damaligen Benzinpreis von bloß 1,40 DM (rund 72 ct) pro Liter fielen Medien, InteressenvertreterInnen und Parteikonkurrenz über die Grünen her. „Grüner Albtraum“ titelte die Bild, „Selbstmord für den Standort Deutschland“ eine andere Zeitung. Die Folge: Die Partei sackte in den Wahlumfragen von zehn auf sechs Prozent Zustimmung ab, und die (dennoch) folgende rot-grüne Bundesregierung unter Bundeskanzler Schröder führte nur ein sehr behutsames ökologisches „Steuerreförmchen“ ein: Der Liter Benzin und Diesel wurde über mehrere Jahre verteilt um insgesamt 30 Pfennige (15 ct) zusätzlich besteuert. Danach gab es – aufgrund des heftigen politischen Gegenwinds und entgegen der eigentlichen Planung – keine weiteren Ökosteuerschritte.
Nur knapp sieben Prozent der WählerInnen hatten sich 1998 letztlich für ein grünes Kreuz an der Wahlurne erwärmen können. Auch wenn sich Wahlergebnisse nie auf einen einzelnen Programmpunkt einer Partei – und sei er noch so prominent – zurückführen lassen, lieferten die Ereignisse im Sommer 1998 doch einen frühen Hinweis auf die begrenzte Popularität ambitionierter Klimapolitik. Dass dies kein Einzelfall ist, belegen seither grenzübergreifend Verlauf und Resultat verschiedener klimapolitischer Diskurse.
Eine besonders differenzierte Messung der Akzeptanz einzelner Politikinstrumenten ermöglicht das politische System der Schweiz mit seinen direktdemokratischen Elementen. Die Grünliberale Partei der Schweiz brachte im März 2015 das u. a. mit Klimaschutz begründete steuerpolitische Reformprojekt "Energie- statt Mehrwertsteuer" zur Volksabstimmung. Auch wenn es derartige Volksinitiativen, zumal von Kleinparteien, traditionell schwer haben an der Urne, war das Resultat mit rund 92 Prozent Nein-Stimmen ein vernichtendes Urteil. Dass manchmal bereits der Protest der Straße ausreicht, zeigen die Ereignisse in Frankreich im Herbst 2018. Die sogenannte Gelbwesten-Bewegung verhinderte die geplante, eher bescheidene Erhöhung der Benzin- und Dieselsteuern um wenige Cent pro Liter. Hier ist jedoch zu berücksichtigen: Es lag vor allem an der sozial unausgewogenen Ausgestaltung und der Einbettung in eine zunehmend unbeliebte neoliberale Reformagenda von Präsident Macron, dass eine überschaubare Steuererhöhung so weitreichende Proteste auslöste.
Im Bundestagswahlkampf 1998 polemisierten CDU und CSU heftig gegen die von den Bündnisgrünen vorgeschlagenen (stufenweisen) Preiserhöhungen für fossilen Kraftstoff; Quelle: Konrad-Adenauer-Stiftung/WikimediaCommons, Bundesarchiv/GHI-DC
Hat selbst marginal wirksame Klimapolitik schlechte Chancen in der Bevölkerung, sobald es über unverbindliche Meinungsumfragen hinausgeht? Dass es auch ganz anders ausgehen kann, zeigt das Abstimmungsresultat über ein neues Energiegesetz an der sogenannten Landsgemeinde im Schweizerischen Kanton Glarus im September 2021. Die deutliche Mehrheit der auf dem Marktplatz physisch anwesenden Abstimmungsberechtigten votierte für eine kurzfristig eingebrachte markante Verschärfung des vorliegenden Regierungsvorschlags: Seitdem dürfen zugunsten des Klimaschutzes keine neue Öl- und Gasheizungen mehr eingebaut werden – und das in einem eher bürgerlich-konservativen Kanton.
Wovon also hängt es ab, ob energie- und klimapolitische Instrumente wie Ökosteuer oder CO2-Preis, Glühbirnenverbot oder Tempolimit in der Bevölkerung auf Akzeptanz stoßen? Welche Einflussfaktoren sind relevant, welche weniger?
Dieser Artikel versucht, mithilfe der aktuellen sozialwissenschaftlichen Forschung eine Antwort zu finden. Nicht zuletzt, um damit eine Grundlage an der Hand zu haben, wie wirksame klimapolitische Instrumente mehrheitsfähig gestaltet und kommuniziert werden können. Aus diesem Grund geht es im Folgenden um die Gründe für Akzeptanz und Ablehnung, die mit der politischen Maßnahme und ihrer Kommunikation zusammenhängen. Nicht betrachtet werden Einflussfaktoren, die mit dem Individuum zusammenhängen – die soziodemographischen und persönlichkeitsspezifischen Aspekte (vgl. z.B. Ejelöv/Nilsson 2020) – oder die auf den gesamtgesellschaftlichen Kontext zurückzuführen sind – wie z. B. die volkswirtschaftliche Lage oder die mediale Problemaufmerksamkeit.
Ist eine Klimaschutzmaßnahme wirksam, erhöht das natürlich die Akzeptanz – wichtig ist dabei die wahrgenommene Wirksamkeit
„Warum sollte ich einem Tempolimit zustimmen, wenn sich ohnehin keiner dran hält? Warum für eine Flugticketabgabe votieren, wenn die Menschen doch genauso viel fliegen wie zu vor?“ Was hier als intuitiv nachvollziehbares Statement formuliert ist, bildet eine wesentliche Voraussetzung gesellschaftlicher Akzeptanz von klimapolitischen Instrumenten ab: deren wahrgenommene Wirksamkeit (Drews/van den Bergh 2016). Entscheidend ist dabei nicht die tatsächliche Wirkung der Maßnahme, sondern die subjektive Einschätzung ihrer Wirksamkeit.
So gelten „harte“ Politikmaßnahmen wie Tempolimit oder Ölheizungsverbot unter ExpertInnen häufig als wirksam, weil sie den Verhaltensspielraum durch ordnungsrechtliche Vorgaben direkt beeinflussen. Trotzdem attestieren Befragte in Meinungsumfragen und sozialwissenschaftlichen Studien diesen Eingriffen oft nur eine begrenzte Wirksamkeit. Inwiefern das an strategischem Antwortverhalten („Wenn mir eine Einschränkung nicht passt, bewerte ich sie als unwirksam“) liegt oder an grundlegenden Glaubenssätzen über die Effektivität staatlicher Eingriffe („das kontrolliert doch sowieso keiner“), mag im Einzelfall unterschiedlich sein.
Dass die wahrgenommene Wirksamkeit klimapolitischer Instrumente äußerst relevant ist, kann man aber auch an politischen Gegen-Kampagnen ablesen. So wurde die Novellierung des Schweizer CO2-Gesetzes 2021 mit dem zentralen Attribut „nutzlos“ bekämpft: Die Kampagne brachte die Novelle denn auch zun Fall. Denn wer stimmt schon für ein Gesetz, das angeblich ohnehin nichts bringt?
Ein zweiter wichtiger Faktor: Ob ein klimapolitischer Instrumentenvorschlag als gerecht empfunden wird
Ein weiteres Schlagwort im Kampagnen-Claim gegen das Schweizer CO2-Gesetz war damals „ungerecht“. Es macht deutlich, dass es bei der Akzeptanz von Maßnahmen auch um deren soziale (Neben-)Wirkungen wie Gerechtigkeit oder Fairness geht: Wird ein klimapolitischer Instrumentenvorschlag als gerecht empfunden, wird er deutlich eher akzeptiert (Bergquist et al. 2022). Die Krux dabei: Was WählerInnen als gerecht empfinden, variiert stark. Schließlich macht es einen großen Unterschied, ob ein Klimaschutzgesetz daran gemessen wird, inwiefern
- bei dessen Entstehung alle relevanten Gruppen faire Mitsprachemöglichkeiten hatten (prozedurale Gerechtigkeit),
- verursachte Kosten nach einem subjektiv angemessenen Schlüssel auf alle Schultern verteilt werden (Verteilungsgerechtigkeit) oder
- derjenige am stärksten beitragen muss, der am meisten zur Problementstehung beigetragen hat (Verursachergerechtigkeit).
Viele Menschen nutzen zur Bewertung politischer Instrumente verschiedene der genannten Gerechtigkeitsprinzipien. Erfahrungen aus dem politischen Campaigning und der sozialwissenschaftlichen Forschung legen nahe, dass Verteilungsgerechtigkeit das am meisten angewandte dieser Prinzipien ist.
Wie sollten die Einnahmen aus einer CO2-Bepreisung verwendet werden? Da gehen die Ansichten offenbar auseinander
Bei fiskalischen Instrumenten wie einer CO2-Abgabe oder Ökosteuer entscheidet über die Akzeptanz auch die Verwendung der generierten Einnahmen. Die Forschungsergebnisse und Meinungsumfragen sind diesbezüglich jedoch widersprüchlich: Es gilt als politischer Common Sense, dass umweltschutzbegründete Steuern und Abgaben dann eher Zuspruch finden, wenn die Einnahmen an die Bevölkerung (und ggf. die Wirtschaft) zurückverteilt werden.
Doch in einer aktuellen repräsentativen Befragung lehnte eine Mehrheit das in Deutschland als Ausgleich für den CO2-Preis geplante Klimageld im Vergleich zu alternativen Mittelverwendungsmechanismen ab. Die Rückvergütung der Mehreinnahmen an die Haushalte war damit für die meisten weniger akzeptabel als z. B. deren Einsatz für staatliche Klimaschutzinvestitionen! Betrachtet man die widersprüchlichen Forschungsergebnisse genauer, wird deutlich, dass es vor allem die eindeutige Zweckbestimmung („earmarking“) ist, die Akzeptanz fördert (Drews/van den Bergh 2016). Das heißt, tendenziell am unbeliebtesten ist eine Klimaabgabe, deren Einnahmen undifferenziert in den allgemeinen Staatshaushalt fließen.
Unabhängig davon ist zu berücksichtigen, dass es wie bei der Gerechtigkeit um die subjektive Wahrnehmung geht: In meiner eigenen frühen Forschung, einer qualitativen Untersuchung zur Akzeptanz der 1999 in Deutschland eingeführten Ökosteuer, wurde deutlich, dass der Mittelverwendungsmechanismus (in diesem Fall die Senkung der Lohnnebenkosten) den meisten Menschen gar nicht bekannt war. Und selbst wer unter den Befragten den Mechanismus kannte, der verstand ihn nicht. Und wer ihn verstand, der akzeptierte ihn noch längst nicht.
Bei einer „Ökosteuer“, so das Argument vieler Interviewpartner, müsse das Geld doch konsequenterweise auch in ökologische Maßnahmen fließen! Die politische Idee, fossilen Energieverbrauch teurer zu machen und zugleich Arbeit billiger, um der Umwelt zu nützen, die Sozialsysteme zu stabilisieren und die Schaffung neuer Arbeitsplätze zu fördern, mag zwar theoretisch sinnvoll und gut begründet gewesen sein – offenbar war sie für der Öffentlichkeit zu abstrakt und schlicht nicht überzeugend.
Bei unbequemen Maßnahmen hilft es, sie erstmal testweise einzuführen – in der Probephase kann die Zustimmung deutlich steigen
Relevant für die Akzeptanz sind auch die Details der Ausgestaltung einer klimapolitischen Maßnahme. So treffen insbesondere „harte“ politische Instrumente wie ordnungsrechtliche Vorgaben und negative Anreize häufig eher dann auf Zustimmung, wenn sie Teil eines umfassenden Politik-Pakets sind, das auch „weiche“ Instrumente enthält oder die Belastungen auf mehrere Schultern verteilt. Besonders erfolgversprechend scheint die testweise oder schrittweise Einführung klimapolitischer Maßnahmen. Dies belegt eindrucksvoll das Beispiel der City-Maut in Stockholm: Während der probeweisen Einführung der Maßnahme stieg die in Umfragen ermittelte Zustimmung kontinuierlich, sodass sich schließlich eine Referendumsmehrheit für die endgültige Einführung aussprach (Schuitema et al. 2010). Plausibel werden solche Ergebnisse unter anderem durch unseren Status-Quo-Bias: Das, was wir kennen, befürworten wir eher – diese Grunddisposition der menschlichen Psyche ist in vielen Forschungsarbeiten bestätigt worden. Das bedeutet: Durch eine Testphase oder graduelle Einführung kann die Abwehr gemildert werden. Die Bevölkerung wird mit der Maßnahme vertraut, kann (hoffentlich) ihre Wirksamkeit verifizieren – und tendiert dann stärker zu Zustimmung, wenn es um die endgültige Einführung geht.
Kehren wir noch einmal zu dem berühmten "Fünf-Mark-Benzinpreis"-Beispiel zurück: 1998 wollten bloß sieben Prozent der bundesdeutschen WählerInnen jener Partei ihre Stimme geben, die sich für eine ökologisch motivierte, markante Verteuerung von Energie einsetzte. 2021 dagegen sprachen sich immerhin 36 Prozent der Befragten einer großangelegten sozialwissenschaftlichen Akzeptanzstudie für einen CO2-Preis aus. Das ist zwar noch keine Mehrheit, legt aber nahe, dass die Zustimmung für klimapolitische Maßnahmen in der Bevölkerung deutlich gestiegen ist. Soll dieser Wert weiter wachsen, sind wahrgenommene Wirksamkeit einer Maßnahme und die Gerechtigkeit besonders relevant – darin ist sich die Forschungsliteratur weitgehend einig. Bei fiskalischen Instrumenten wie einer CO2-Abgabe oder Energiesteuer kommt die Verwendung der Einnahmen als zusätzliches Akzeptanzkriterium hinzu. Diese Erkenntnisse können die Grundlage liefern für eine akzeptanzfördernde Gestaltung und Kommunikation klimapolitischer Maßnahmen.
Eine Garantie, dass ambitionierte Klimapolitik auf demokratische Mehrheiten trifft, liefert dies nicht. Wenn sich die Politik tatsächlich weniger an parteipolitischen Befindlichkeiten und machtpolitischen Abwägungen orientiert und mehr an der Bevölkerung – dann kommt es darauf an, wo die Bevölkerung ist. Damit sind wir bei den eingangs erwähnten individualpsychologischen Faktoren: Verfügen wir über genug Problem- und Lösungswissen? Empfinden wir ausreichend Selbstwirksamkeit, also die Überzeugung, dass wir überhaupt etwas tun können, das Problem zu lösen? Und sind für uns Menschen mehrheitlich die Werte wichtig, mit denen sich der Schutz von Klima, Natur und künftigen Generationen begründen lässt? Auf diese Faktoren lässt sich nicht kurzfristig Einfluss nehmen. Hier geht es um Wertevermittlung, Klimakommunikation, Umweltbildung.