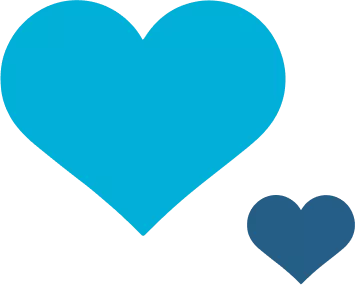Müsste man in Österreich nicht Angst haben, dass mit dem Klimawandel erst der Schnee und dann die Wintersportler wegbleiben? Und müsste diese konkrete Gefahr nicht zum Handeln motivieren? Auf dem Klimakommunikations-Kongress K3 in Salzburg antworten Referenten und Teilnehmer einhellig: Nein. Denn zum einen habe man die Schneepisten in den vergangenen Jahren gut künstlich beschneien können. Und zum anderen sei Angst generell ein schlechter Weg, um Menschen für eine Sache zu begeistern.
"Was kann ich allein schon gegen den Klimawandel tun?" - das fragen sich viele, wenn man ihnen die Bedrohung durch steigende Temperaturen erläutert. Wenn man nicht die Gefahr verringern kann, konzentriert man sich darauf, seine Angst loszuwerden, erläutern Isabella Uhl von der Universität Salzburg und Adrian Brügger von der Universität Bern in einem Workshop zur Rolle der Emotionen in der Klimakommunikation. Ihre Empfehlung lautet: konkretere Ziele in den Blick zu nehmen, bei denen Menschen stärker das Gefühl haben, etwas beitragen zu können – also beispielsweise die Energieversorgung eines Ortsteils oder die Sanierung ihres Hauses.
Das Foto eines stolzes Managers wirkt stärker als eine Power-Point-Präsentation
Konsens ist in Salzburg aber auch, dass Klimakommunikation nicht ohne Emotionen auskommt – Wissen allein genügt nicht, um Menschen zum Handeln zu bewegen. Und der Klimawandel berührt nur bei wenigen Menschen das Herz: Nur 19 Prozent der Deutschen verbinden ihn zum Beispiel mit Hoffnung und nur 14 Prozent berichten von Schuldgefühlen, zeigte kürzlich eine Umfrage eines europäischen Teams um Katharine Steentjes von der Cardiff University. Am besten motivieren positive Gefühle, berichten die Teilnehmer des Workshops von Uhl und Brügger, und es sei wichtig, eine Geschichte dazu zu erzählen. Das Foto eines stolzen Managers, der seine Firma umweltfreundlich gestaltet hat, wirke besser als eine Powerpoint-Folie über das Projekt. Und um den Klimawandel stärker erfahrbar und "erfühlbar" zu machen, sollte man sich auf die Folgen konzentrieren statt auf die Ursachen: die bereits beobachteten Auswirkungen und vielleicht auch – mit den Mitteln der virtuellen Realität – die zu erwartenden.
Positive Emotionen können auch durch Vorbilder ausgelöst werden – und Vorbilder zeigen wiederum, wie einflussreich der Einzelne sein kann. Die beiden Psychologen Uhl und Brügger zitieren ihre Kollegin Niki Harré von der University of Auckland in Neuseeland: Man müsse anderen eine nachhaltigere Lebensweise – sichtbar – vorleben, um sie dafür zu gewinnen, argumentiert sie in ihrem Buch Psychology for a better world, das bald in einer überarbeiteten Fassung online veröffentlicht werden soll.
Vorbilder haben einen erheblichen Einfluss auf das Verhalten von Menschen
Ein Beispiel steuert Brügger selbst bei: Er entschied sich kürzlich zu einer 24-stündigen Bahnfahrt zu einer Fachkonferenz, die dreimal teurer war als ein Flug. Doch er verabredete sich mit anderen Teilnehmern im Zug - und zeigte im Workshop nun Fotos von lustigen Runden im Bordrestaurant. Auf der Konferenz erhielt er schließlich (wie alle anderen Bahnreisenden) eine Medaille, die er sich in Salzburg stolz umhängt. Und er zitiert eine holländische Studie, in der die Wirkung eines schlechten Beispiels untersucht wurde: Das Forscherteam um Kees Keizer zählte, wie viele Fahrradfahrer einen Infozettel an ihrem Rad auf den Boden werfen - jeder Dritte tat es. Doch nachdem die Forscher das Gebäude, neben dem die Fahrräder geparkt werden, mit Graffiti beschmiert hatten, verdoppelte sich der Anteil.
Ein anderer Weg, Gefühle von Hoffnung und Einfluss zu wecken, geht über Gruppen. Als Mitglied einer Gruppe fühle man sich stärker, sagt der Psychologe Torsten Grothmann von der Universität Oldenburg, der am Montagvormittag auch einen der Einführungsvorträge der K3-Konferenz gehalten hat. Daher lohne es sich, Gruppen anzusprechen, die zusammen etwas bewirken können – beispielsweise alle Einwohner einer Kommune. Es sei sogar möglich, neue Gruppen zu gründen – etwa durch Kooperationsbörsen. Als Beleg zitiert Grothmann eine Studie von Leipziger Forschern, die zeigt, welchen Unterschied es macht, wenn man die Probanden nicht als Individuen, sondern als Gruppe anspricht: beispielsweise als junge Menschen unter 30 Jahren. Die Probanden trauten nicht nur der Gruppe eher zu, die Wende zu einer nachhaltigeren Lebensweise zu schaffen. Das positive Gruppenerlebnis, gemeinsam etwas zu erreichen, stärkte auch die Bereitschaft jedes einzelnen Grupenmitglieds, als Individuum zu handeln. "Und das", so Grothmann, "ist doch ein schöner Nebeneffekt."
Alexander Mäder