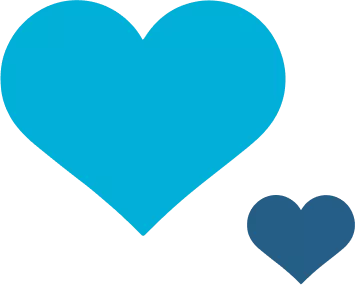Praktisch täglich tickern Überschriften wie diese über die Fachinformationsdienste zur Klimaforschung: Fälle von massenhaftem Fischsterben in Binnenseen in den gemäßigten Klimazonen der Nordhalbkugel könnten sich bis Ende des Jahrhunderts vervierfachen. +++ Beobachtungsdaten von Satelliten stimmen in manchen Regionen sehr gut mit den Ergebnissen von Klimamodellen überein, in anderen weniger gut. +++ 77 Prozent der 520 größten Städte weltweit werden bis zum Jahr 2050 einen deutlichen Wandel der klimatischen Bedingungen erleben.
Jeder Satz steht für eine gerade erschienene Wissenschaftspublikation zum Klimawandel. Inzwischen dürften es Hunderte pro Woche sein, die in bekannten und weniger bekannten Fachjournalen überall auf der Welt erscheinen. Aber wie relevant sind die Ergebnisse jeweils? Wie verlässlich? Und was genau bedeuten sie für das größere Bild des Wissens?
Übersetzungsarbeit gehört schlicht zum wissenschaftlichen Alltag
Nur relativ selten finden wissenschaftliche Studien den Weg in eine breitere Öffentlichkeit, die Mehrzahl wird nur von wenigen Fachkollegen im jeweiligen Spezialgebiet gelesen und verstanden. In der Regel seien die Arbeiten so speziell, dass selbst Experten aus angrenzenden Fachdisziplinen fast wie Laien davorsitzen, erklärt Gregor Hagedorn, Biodiversitäts-Forscher und Mitgründer der Initiative "Scientists for Future". Der überwiegenden Mehrheit der Wissenschaftler geht es deshalb nicht anders als einer x-beliebigen Bürgermeisterin oder einem Aktivisten, wenn sie sich über neue Forschungsergebnisse informieren wollen: "Sie greifen auf Sekundärquellen zurück", etwa auf journalistische Berichte in Zeitungen oder Fachmagazinen.
 Gregor Hagedorn, Mitgründer der "Scientists for Future", war einer der Referenten im K3-Workshop zur besseren Wissenschaftskommunikation; Foto: DKK/Stephan Röhl
Gregor Hagedorn, Mitgründer der "Scientists for Future", war einer der Referenten im K3-Workshop zur besseren Wissenschaftskommunikation; Foto: DKK/Stephan Röhl
Übersetzungsarbeit gehört also zum wissenschaftlichen Alltag - und der Workshop "Mehr Öffentlichkeit wagen! Es gibt keine Wissenschaft ohne Kommunikation" auf dem K3-Kongress Ende September in Karlsruhe stellte genau diese Frage in den Mittelpunkt: Wie gelingt es der Wissenschaft, ihre Ergebnisse wirksamer in die Gesellschaft hinein zu kommunizieren?
Gekommen waren Mitarbeiter von Pressestellen, Wissenschaftlerinnen - aber kaum Journalisten. Ein Konferenzteilnehmer aus Österreich, der viel zu Schnee und Tourismus arbeitet, bekannte offenherzig: Er sei ja gern bereit, sich "zwei, drei Stunden Zeit für ein Gespräch mit einem Journalisten zu nehmen" - nur bringe kaum jemand, der bei ihm anruft, so viel Zeit mit. Den meisten Journalisten gehe es um ein kurzes Gespräch - davon wiederum halte er nichts, weil es dabei oft zu Missverständnissen komme, die dann – gedruckt oder auf Internet-Seiten – jahrelang durch die Welt wabern. Eine Öffentlichkeitsarbeiterin aus Hessen, die vor einem halben Jahr selbst noch Journalistin beim ZDF war, bittet darum, die Arbeitsbedingungen und Systemzwänge im Medienbetrieb zu verstehen: "Journalisten sind auf Zuspitzungen angewiesen, vor denen sich die Wissenschaft oft scheut."
"Es gehört zur Wissenschaftskommunikation, Zusammenhänge herzustellen"
Nicole Aeschbach vom geografischen Institut der Universität Heidelberg unterscheidet drei Formen von Wissen: das Systemwissen (Grundlagen), das Zielwissen (Lösungen) und das Transformationswissen ("jenes Wissen, dass wir über den gesellschaftlichen Prozess besitzen"). Für sie ist wichtig, in jedem Einzelfall festzustellen, um welche Wissensform es in der jeweiligen Situationen vermittelt werden soll. Denn bei jeder seien andere Kommunikationstechniken sinnvoll.
Peter Limacher von der schweizerischen Stiftung "Science et Cité" forderte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf, auch aus ihrer Perspektive unkonventionelle Kommunikationsmittel zu nutzen: Facebook, Blogs, YouTube – das seien zwar nicht die im Fach üblichen Kanäle, Ergebnisse der Klimaforschung zu verbreiten. "Sie können aber erfolgreiche Wege sein." Er selbst nutze beispielsweise Facebookgruppen wie "Wald und Pflanzen" mit 15.000 Followern oder die Gruppe "Bergsüchtige", so Limacher: "Auch dort kann wissenschaftliche Arbeit Anregung geben."
Gregor Hagedorn plädierte dafür, den Zeithorizont zu erweitern. "Wissenschaft neigt dazu, nur den jeweils neuesten Sachstand zu kommunizieren." Oft gelte das Motto: "Wir können doch nicht nochmal das verbreiten, was seit 30 Jahren schon Sachstand ist." Doch seiner Erfahrung nach haben insbesondere viele Politikerinnen und Politiker in Entscheidungspositionen noch nicht einmal diesen - vermeintlich unspannenden - Sachstand parat. Er appellierte an alle Anwesenden: "Es gehört auch zur Wissenschaftskommunikation, Zusammenhänge herzustellen."
Simple Analogien können wissenschaftliche Befunde verständlich machen
Es war Nicole Aeschbach, die am Ende des Workshops dafür sorgte, dass die anwesenden Kommunikatorinnen und Kommunikatoren noch einige praxistaugliche Hinweise in ihre Notizbücher schreiben konnten: "Zeitdruck auf der Seite der Journalisten – fachliche Korrektheit als oberstes Ziel auf der Wissenschaftsseite", brachte sie die unterschiedlichen Systemlogiken auf den Punkt. "Wichtig sind Personen an der Schnittstelle, weil sie beide Seiten kennen, verstehen und vermitteln helfen", etwa die Pressestellen der Wissenschaftsinstitute.
Von den drei eingangs erwähnten Fachpublikationen schaffte es übrigens eine weltweit in die Medien: die Studie über Folgen des Klimawandels für die 520 Großstädte. Sie stammte von einem Team der ETH Zürich und erschien diesen Sommer im Journal PLOS one. In der Fachwelt rümpfte mancher die Nase über die Untersuchung, aber die Autoren hatten ihre Ergebnisse für die Allgemeinheit sehr verständlich und anschaulich: Sie gaben nicht abstrakte Daten an für die Klimata, die in den jeweiligen Metropolen erwartet werden - sondern nutzten einen Kniff, der ebenso simpel wie genial ist: Sie suchten jeweils "Partnerstädte", in denen bereits heute ähnliche Verhältnisse herrschen. London wird demnach Mitte des Jahrhunderts Verhältnisse bekommen wie derzeit Madrid, das Klima in Paris wird den heute im australischen Canberra herrschenden Bedingungen entsprechen. Darunter kann sich jeder etwas vorstellen.
Nick Reimer