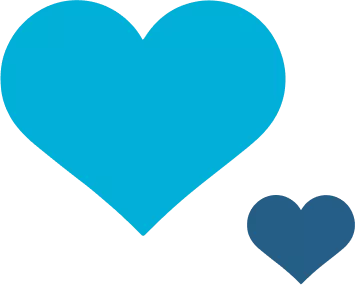Was soll das eigentlich sein – Klimakommunikation? Und wieso beschäftige ich mich als Klimajournalist seit fast zwei Jahren mit wenig anderem? Wer das für sinnlose oder banale Fragen hält, sollte wissen: Das Wort „Kommunikation“ hat für uns Journalist:innen eine schillernde Doppeldeutigkeit.
Zum einen ist es natürlich unser Handwerk zu kommunizieren: Presse, Rundfunk und Internetdienste leben davon und dafür, Botschaften und Inhalte an ein Publikum zu übermitteln, das davon einen Nutzen hat und im Gegenzug auf die eine oder andere Weise die Gehälter und Produktionskosten bezahlt.
Zum anderen klingt es oft etwas abschätzig, sobald Medienleute über Kommunikation sprechen, besonders wenn sie das vom Journalismus abgrenzen. Kommunikations-Agenturen machen nämlich in der Regel Werbung oder „Öffentlichkeitsarbeit“. Unternehmens- oder Wissenschafts-Kommunikation verfolgt unvermeidbar die Interessen der Institution, für die sie spricht. Diese Interessen mögen weiter gefasst sein als ein höher Umsatz oder Gewinn – aber sie bleiben Interessen einer nicht-journalistischen Organisation. Das ist natürlich legitim, nur unterliegt es eben einer anderen Logik und nicht dem Ethos der Unvoreingenommenheit, den wir Journalist:innen für uns reklamieren.
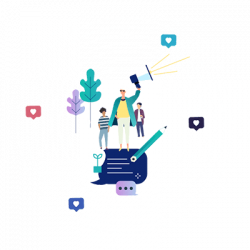 Dennoch bin ich überzeugt, dass auch Klimajournalist:innen etwas von den Erkenntnissen einer Klimakommunikation auf bestem wissenschaftlichen Stand lernen können, ja dringend lernen müssen, wenn sie ihre gesellschaftliche Aufgabe erfüllen wollen. Es ist eine Aufgabe, die zum Beispiel die kürzlich veröffentlichte „Klimacharta“ des Netzwerks Klimajournalismus so skizziert: „Klimajournalismus trägt durch Aufklärung zu einem klaren ethischen und ökologischen Ziel bei: dem Erhalt der Lebensgrundlagen für alle Lebewesen auf diesem Planeten.“ Und es ist eine Aufgabe, der die Medien einem Sammelband der Initiative Klima vor Acht zufolge „seltsam passiv“ begegnen.
Dennoch bin ich überzeugt, dass auch Klimajournalist:innen etwas von den Erkenntnissen einer Klimakommunikation auf bestem wissenschaftlichen Stand lernen können, ja dringend lernen müssen, wenn sie ihre gesellschaftliche Aufgabe erfüllen wollen. Es ist eine Aufgabe, die zum Beispiel die kürzlich veröffentlichte „Klimacharta“ des Netzwerks Klimajournalismus so skizziert: „Klimajournalismus trägt durch Aufklärung zu einem klaren ethischen und ökologischen Ziel bei: dem Erhalt der Lebensgrundlagen für alle Lebewesen auf diesem Planeten.“ Und es ist eine Aufgabe, der die Medien einem Sammelband der Initiative Klima vor Acht zufolge „seltsam passiv“ begegnen.
Das Handbuch zur Klimakommunikation, das ich in Zusammenarbeit mit klimafakten.de veröffentlichen konnte, klammert Journalist:innen aus seinen Zielgruppen eher aus. Wenn Kolleg:innen etwas nützlich darin finden, umso besser. Aber das Buch richtet sich vor allem an Aktivisten und Wissenschaftlerinnen, an Behörden- und Firmenvertreter, an Mitglieder von Initiativen und NGOs, an Menschen aus Politik, Wirtschaft und alle anderen, die über das Klima sprechen wollen. Sie eint, dass sie ein Ziel haben, dass sie etwas erreichen und andere überzeugen wollen, um die größte aktuelle Bedrohung der Menschheit abwenden, die Klimakrise. Sie möchten, um eine Formulierung aus einem frühen Exposé des Klima vor Acht-Buch zu zitieren, „nicht mehr Teil des Problems, sondern Teil der Lösung“ sein.
Für viele Journalist:innen jedoch gehört es gerade nicht zur Jobbeschreibung, ein Ziel jenseits ihrer Berichterstattung zu haben oder „Teil“ von irgendwas zu sein, nicht einmal von „der Lösung“. Sie wollen nicht in den Verdacht geraten, sich „mit irgendeiner Sache gemein zu machen“ – um ein oft missverstandenes Motto des Grandseigneur der ARD-Tagesthemen, Hanns-Joachim Friedrich zu zitieren. Ihr Selbstverständnis verlangt meist „objektive“ Berichterstattung und größtmögliche „Neutralität“ (die auch im Publikum viele Menschen erwarten). „Aktivistisch“ zu sein, ist da eine schwerwiegende Kritik.
Und mit genau diesem Vorwurf haben manche (oft konservative) Medien versucht, den langsamen Aufbruch der eigenen Branche zu einem besseren Klimajournalismus in Misskredit zu bringen. Zum Beispiel die Neue Zürcher Zeitung (NZZ): Sich im Kampf gegen den Klimawandel stärker zu engagieren, hieß es dort Ende 2020 in einem Kommentar, stelle einen Mangel an Distanz dar und untergrabe die journalistische Glaubwürdigkeit. Um es vorweg zu nehmen: Ich halte das für Unsinn. Wir müssen uns beteiligen, uns einmischen, weil wir nur so die journalistische Glaubwürdigkeit retten können. Ein Jahr später startete dann dieselbe Zeitung übrigens ihren kostenpflichtigen Klima-Newsletter Planet A.
Der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen fordert eine „kämpferische, engagierte Objektivität“, die ein „dümmliches Neutralitätsideal“ verdrängen müsse
Die Diskussion, die über die Vorwürfe zum Beispiel der NZZ entbrannte, war trotzdem nicht fruchtlos, sie hat das Konzept der journalistischen Objektivität präzisiert. Der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen von der Universität Tübingen sprach im Deutschlandfunk von einer „kämpferischen, engagierten Objektivität“, die ein „dümmliches Neutralitätsideal“ verdrängen müsse. Journalist:innen könnten „Nachhaltigkeit als Nachrichtenfaktor“ begreifen, so wie es bisher Aktualität und Originalität sind. Sein Kollege Jay Rosen von der New York University mahnte vor Jahren in einem Offenen Brief „ein gutes politisches Urteil“ an, das sich Medienvertreter:innen auch und gerade dann bewahren sollten, wenn sie journalistisches und politisches Handeln trennen.
Längst hat auch der zunehmend populäre, sogenannte konstruktive Journalismus den Ruch abgeschüttelt, dass die in jedem Beitrag präsentierten Lösungen des jeweils beschriebenen Problems dem Ganzen einen aktivistischen oder werblichen Charakter gäben. In dem erwähnten Klima vor Acht-Sammelband beschreibt Maren Urner, Neurowissenschaftlerin und Mitgründerin von Perspective Daily, das Konzept speziell mit Blick auf die Klimakrise als „Weg aus der Misere“. Statt wie der klassische Journalismus in die Vergangenheit zu blicken, um Ursachen und Verantwortung festzumachen, oder in die Gegenwart, um Folgen zu beschreiben, interessiere sich der Konstruktive Journalismus explizit für die Zukunft und damit für Auswege, so Urner: „Er fragt sowohl übergeordnet als auch ganz konkret stets ,Was jetzt?‘.“
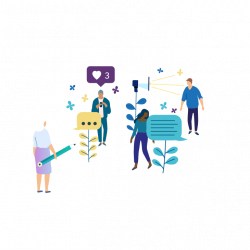 Die Linien dieser Diskussion hier im Detail nachzuzeichnen, führt zu weit. Worauf es aber ankommt: Nicht einmal der so geschärfte, um neue Aspekte erweiterte Begriff von Objektivität zwingt Journalist:innen dazu, „Teil der Lösung“ sein zu sollen. Sie können es, aber sie müssen es nicht. Der oben zitierte Satz hatte jedoch noch einen ersten Teil: nicht mehr „Teil des Problems“ zu sein. Und das ist sogar mit den engsten, traditionellsten Vorstellungen von journalistischem Ethos zu vereinbaren. Es ist nicht nur kein Hindernis, sondern sogar die Basis für verantwortungsvolle journalistische Arbeit.
Die Linien dieser Diskussion hier im Detail nachzuzeichnen, führt zu weit. Worauf es aber ankommt: Nicht einmal der so geschärfte, um neue Aspekte erweiterte Begriff von Objektivität zwingt Journalist:innen dazu, „Teil der Lösung“ sein zu sollen. Sie können es, aber sie müssen es nicht. Der oben zitierte Satz hatte jedoch noch einen ersten Teil: nicht mehr „Teil des Problems“ zu sein. Und das ist sogar mit den engsten, traditionellsten Vorstellungen von journalistischem Ethos zu vereinbaren. Es ist nicht nur kein Hindernis, sondern sogar die Basis für verantwortungsvolle journalistische Arbeit.
Was „Teil des Problems“ zu sein in Bezug auf die Kommunikation rund um den Klimawandel bedeutet (und wie man sich davon befreit) – das haben Kommunikationsforschung und Psychologie in vielen Einzelheiten herausgearbeitet. Das „Handbuch Klimakommunikation“ hat sie zusammengefasst und für die Praxis aufgearbeitet. Auch wir Journalist:innen können ihm deshalb Hinweise entnehmen, was wir in Zukunft vermeiden sollten – und Tipps, was wir stattdessen tun können. Darum soll es im Folgenden gehen.
* * *
Fangen wir an mit den Praktiken des real existierenden Journalismus, die wir abstellen sollten, weil sie zu erkennbar unerwünschten Resultaten führen. Das erste Beispiel ist die sogenannte False Balance, die zum Beispiel der Hamburger Kommunikationsforscher Michael Brüggemann erkundet hat. Sie ist oft eine Folge einer Regel, die im Politikjournalismus verbreitet ist: zu jeder Aussage auch eine Gegenstimme einzuholen. Berichtet man über politischen Kontroversen, ist dies sinnvoll – aber in der Berichterstattung über den Klimawandel als wissenschaftliches Phänomen wird diese Regel nicht nur sinnlos, sondern schädlich: Zu einer wissenschaftlich gesicherten Aussage, etwa über die Ursachen des Klimawandels, gibt es keine ebenso fundierte Gegenmeinung. Anders als in der Politik oder bei weltanschaulichen Fragen gibt es bei wissenschaftlichen Kontroversen sehr oft ein objektives „richtig“ oder „falsch“. Hier liegt auch der Grund, warum Pörksen von einem „dümmlichen Neutralitätsideal“ sprach.
Im Politikjournalismus gilt, zu jeder Aussage auch eine Gegenstimme einzuholen. Bei politischen Kontroversen ist dies sinnvoll – im Wissenschaftsjournalismus aber ist diese Regel nicht nur sinnlos, sondern schädlich
Die schädliche, vermeintliche Objektivität der False Balance haben immer wieder Interessenvertreter der fossilen Wirtschaft oder marktradikaler politischer Kreise ausgenutzt. Ihr Ziel war es, Zweifel am Forschungsstand zur Erderhitzung zu säen, um politische Gegenmaßnahmen zu verzögern und weiterhin ungestört ihren klimaschädlichen Geschäften nachzugehen. (Das Standardwerk zu dieser Strategie stammt von Naomi Oreskes und Eric Conway: The Merchants of Doubt oder auf Deutsch: Die Machiavellis der Wissenschaft. Sie erklären darin auch, dass die ideologische Basis der Strategie ein Delegitimieren jeglichen staatlichen Eingriffs in die Wirtschaft war.) False Balance und das ideologisch motivierte Streuen wissenschaftlicher Zweifel sollten wir Journalist:innen keinesfalls dulden. Wir werden sonst unserer Verantwortung nicht gerecht, sorgfältig zu recherchieren und ein möglichst adäquates Bild der Realität zu zeichnen. Zum Glück haben das schon viele Kolleg:innen erkannt. Aber in mancher Talkshow-Redaktion leben die alten Reflexe noch fort.
Interessanterweise dürfte die Tradition des Einholens einer anderen Meinung im Klimajournalismus in Zukunft dennoch eine wichtige Rolle spielen – jedoch nicht beim Berichten über Klimaforschung, sondern über Klimapolitik. Wenn nämlich in Politik und Gesellschaft endlich über das „Wie“ von wirksamem Klimaschutz gestritten wird, nicht mehr über das „Ob“, dann spielen politische Positionen auf allen Seiten eine wichtige Rolle. Dann hat jede Partei und jede gesellschaftliche Strömung etwas zu sagen, dann ist Platz für alle Ideen, und dann haben wir in den Medien Gelegenheit und sogar Verpflichtung, unser aller Interessen und Ziele zu wägen. Das mag anstrengend sein, ist aber notwendig. „Erfolg werden wir daran erkennen“, hat mir George Marshall, Gründer der britischen Organisation Climate Outreach einmal gesagt, „dass über Klimaschutz auf eine Art geredet wird, die uns überhaupt nicht gefällt.“
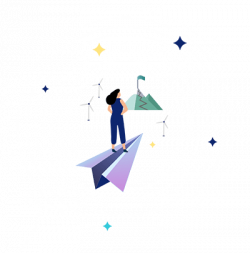 Dieser Streit über die Ausgestaltung der nötigen Transformation befreit viele Journalist:innen quer durch alle Ressorts aus der Zwickmühle grundsätzlich für Veränderungen zu sein, aber die traditionellen Werte eines unabhängigen Journalismus aufrechterhalten zu wollen. Auch sie könnten so in ihrer Arbeit dazu beitragen, dass diese Gesellschaft den Weg aus der Klimakrise findet – und es weiterhin von sich weisen, irgendwie Partei zu ergreifen. Sie müssen dazu wie gehabt die politische und gesellschaftliche Debatte sortieren und die benutzten Argumente einordnen. Dazu sollte eine Orientierung auf die Zukunft sowie stets die Prüfung gehören, ob die jeweils vertretenen Vorschläge wirklich zu dem Niveau an Emissionsminderung führen können, das laut Pariser Abkommen und deutscher Klimagesetze und Gerichtsbeschlüsse notwendig ist. Darauf zu achten, bedeutet keine Parteinahme, ist kein Aktivismus, sondern eine relevante Information für die Leserschaft, die Zuschauer und Zuhörerinnen. Es ist sozusagen eine Aktualisierung und Operationalisierung des Begriffs „Neutralität“ in Zeiten der Klimakrise.
Dieser Streit über die Ausgestaltung der nötigen Transformation befreit viele Journalist:innen quer durch alle Ressorts aus der Zwickmühle grundsätzlich für Veränderungen zu sein, aber die traditionellen Werte eines unabhängigen Journalismus aufrechterhalten zu wollen. Auch sie könnten so in ihrer Arbeit dazu beitragen, dass diese Gesellschaft den Weg aus der Klimakrise findet – und es weiterhin von sich weisen, irgendwie Partei zu ergreifen. Sie müssen dazu wie gehabt die politische und gesellschaftliche Debatte sortieren und die benutzten Argumente einordnen. Dazu sollte eine Orientierung auf die Zukunft sowie stets die Prüfung gehören, ob die jeweils vertretenen Vorschläge wirklich zu dem Niveau an Emissionsminderung führen können, das laut Pariser Abkommen und deutscher Klimagesetze und Gerichtsbeschlüsse notwendig ist. Darauf zu achten, bedeutet keine Parteinahme, ist kein Aktivismus, sondern eine relevante Information für die Leserschaft, die Zuschauer und Zuhörerinnen. Es ist sozusagen eine Aktualisierung und Operationalisierung des Begriffs „Neutralität“ in Zeiten der Klimakrise.
* * *
„Teil des Problems“ bleiben wir Journalist:innen überdies, solange wir nicht die Rolle und Funktion von Fakten überdenken. Vermutlich folgen viele einer Maxime, der auch ich viele Jahre lang anhing: Wenn wir nur genügend aufklären, wenn wir die relevanten Informationen zum Klima sachlich präsentieren, wenn wir deutlich vor den Folgen des Einfach-so-weiter-Machens warnen, dann zieht das Publikum irgendwann daraus die richtigen Schlüsse – es verhält sich entsprechend, jedenfalls anders als zuvor. Auch bei Wissenschaftlern und Forscherinnen ist diese Denkweise noch weit verbreitet.
Leider stimmen aber die Annahmen über die fehlenden Fakten und die irgendwann richtig gezogenen Schlüssen nicht. Die Psychologie nennt es Informations-Defizit-Hypothese – und hat diese widerlegt. Gut aufbereitete Fakten sind wichtig, vermutlich auch unverzichtbar, aber nicht ausreichend. Es liegt häufig eben nicht an fehlendem Faktenwissen, dass Menschen bestimmte Dinge nicht tun.
Der menschliche Geist kennt sehr viele Kniffe, Information zu sortieren, bevor sie in relevante Überlegungen einfließen kann. Dabei wirken kognitive Fehlschlüsse, Gewohnheiten und mentale Schleichwege. Was zum Beispiel an externen Informationen nicht passt, wird im Gehirn passend gemacht – oder gleich ganz ignoriert. Das nennt man Bestätigungsfehler oder Confirmation Bias. Weitere Phänomene sind: Man konzentriert sich auf andere, vermeintlich größere Sorgen; man glaubt, die Gefahr werde an einem selbst vorbeigehen; man orientiert sich an der Mehrheit.
Viele Menschen sind überdies von vermeintlich eindeutigen und einfachen, oft aber falschen Aussagen beeindruckt und halten differenziertes Abwägen oder das Einräumen punktueller Wissenslücken für ein Zeichen, dass die damit verbundene Position unglaubwürdig sei oder weniger fundiert. Das bedeutet, wissenschaftlich-redliches Argumentieren kann gegenüber rücksichtsloser Propaganda rhetorisch leicht ins Hintertreffen geraten.
Wir Journalist:innen müssen Rolle und Funktion von Fakten überdenken: Sie sind sicher wichtig, vermutlich auch unverzichtbar – aber nicht ausreichend. Es liegt häufig eben nicht an fehlendem Informationen, dass Menschen bestimmte Dinge nicht tun
Solche psychologischen Mechanismen sind übrigens keine Eigenheit charakterloser oder bildungsferner Zeitgenossen. Sie sind Teil der menschlichen Grundausstattung, wir alle machen das ständig so. Wir sind zwar tatsächlich in der Lage, rationale Entscheidungen zu treffen und diese entschlossen umzusetzen. Aber wir tun es nur äußert selten – meist nutzen wir mentale Schleichwege, um unbequeme Wahrheiten (auch über uns selbst) zu ignorieren und uns um ungeliebte Entscheidungen herumzudrücken. Je intelligenter wir sind, desto leichter fällt es uns dabei, eine nachträgliche, scheinbar rationale Begründung für eine Entscheidung zu konstruieren, die wir schon längst mit dem Bauch getroffen haben. Das hat auch Daniel Kahneman in seinem Buch Schnelles Denken, langsames Denken eindrucksvoll beschrieben.
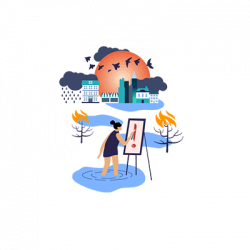 Überdies überwältigt die Klimakrise schnell den menschlichen Geist – George Marshalls Buch zum Thema heißt nicht umsonst Don’t Even Think About It – Why Our Brains Are Wired To Ignore Climate Change. Der Klimawandel überfordert unsere mentalen Verarbeitungs- und Entscheidungskapazitäten, er ist nämlich ein umfassendes Problem, das unübersehbare Folgen für unsere gesamte Lebensweise hat, und ist so langfristig, dass wir von den eigenen Handlungen im Klimaschutz selbst eher wenig profitieren werden.
Überdies überwältigt die Klimakrise schnell den menschlichen Geist – George Marshalls Buch zum Thema heißt nicht umsonst Don’t Even Think About It – Why Our Brains Are Wired To Ignore Climate Change. Der Klimawandel überfordert unsere mentalen Verarbeitungs- und Entscheidungskapazitäten, er ist nämlich ein umfassendes Problem, das unübersehbare Folgen für unsere gesamte Lebensweise hat, und ist so langfristig, dass wir von den eigenen Handlungen im Klimaschutz selbst eher wenig profitieren werden.
Schon die Definition, wo das Problem (und die Lösung) im Kern liegen, ist umstritten. Da reden die einen von Treibhausgasen, und die anderen hören Komfort und Wohlstand. Die einen sagen: „sofortige Reaktion“, die anderen denken, da wird schon bald jemand was Passendes erfinden. Die einen beschwören das gemeinsame, entschlossene Handeln, die anderen blicken sich um und sagen sich: Es macht ja niemand was – warum soll ich allein anfangen? Die wissenschaftlichen und die sozialen Aspekte der Debatte kreuzen einander in bizarren Winkeln.
* * *
In dieser Situation wirkt sich die verbreitete kognitive Dissonanz besonders fatal aus. So nennt es die Psychologie, wenn Wissen und Einstellungen von Menschen nicht so recht zum Verhalten passen. Rational betrachtet ist klar, wie wir aus dem Dilemma am besten herauskommen: anders handeln. Aber meist begnügen wir uns damit, anders zu denken, und die Einstellung langsam, aber effektiv an unsere Trägheit anzupassen. Wir verbrämen das mit Vokabeln wie Erwachsen-werden, Pragmatismus oder Sachzwang.
Konkret im Zusammenhang mit der Klimakrise bedeutet das: Natürlich weiß die überwiegende Mehrzahl der Bürger:innen Deutschlands, dass sich vieles ändern muss. Vier Fünftel der Befragten stimmten daher zum Beispiel bei der Umweltbewusstsein-Studie 2020 des Umweltbundesamtes entweder „voll und ganz“ oder „eher“ der folgenden Aussage zu: „Zugunsten der Umwelt sollten wir alle bereit sein, unseren derzeitigen Lebensstandard einzuschränken.“ Und Viele haben vielleicht sogar immer wieder ein schlechtes Gewissen, weil sie es doch nicht tun. Sie finden dann aber schnell vermeintlich triftige Gründe, warum es schon okay ist, warum sie nichts ändern können und so weiter.
Wir Journalist:innen müssen den Fakten angesichts der kognitiven Abwehrmechanismen unseres Publikums den Weg ebnen. Wenn wir weiter nüchtern lediglich Informationen aus der Klimaforschung präsentieren, ohne uns zu überlegen, wie wir sie einbetten und befördern, dann bleiben wir „Teil des Problems“
Unterlaufen kann man diesen Mechanismus als Journalist:in übrigens, indem man den Fokus auf konkrete, möglichst einfache Lösungsansätze lenkt. Das erleichtert es dem Publikum, die kognitive Dissonanz aufzulösen – und zwar so, dass es das passende Verhalten zur bereits erreichten Einstellung findet.
In diesem Umfeld sind Fakten und vor allem Handlungswissen unverzichtbar, um das noch einmal zu betonen. Wir dürfen sie bei Recherche und Präsentation auf keinen Fall einem Zweck unterordnen. Aber wir müssen als Journalist:innen den Fakten angesichts der kognitiven Abwehrmechanismen den Weg ebnen, den sie nicht von selbst finden. Wenn wir uns weiter darauf konzentrieren, nüchtern und sachlich lediglich Informationen aus der Klimaforschung zu präsentieren, ohne uns genau zu überlegen, wie wir sie einbetten und befördern, dann bleiben wir „Teil des Problems“.
* * *
Wie erweitern wir Journalist:innen unser Handwerkszeug? Beginnen wir mit eher einfachen Veränderungen: Wir sind ja daran gewöhnt, Inhalte so aufzubereiten, dass das Publikum Interesse am Beitrag hat und den Inhalt so versteht, wie wir es geplant haben. Das journalistische Ideal dahinter lautet, Menschen in die Lage zu versetzen, ihre eigene Entscheidung zum Thema zu treffen. „Als Journalisten haben Sie nicht die Aufgabe, den Leuten zu sagen, was sie denken sollen“, formulierte es der US-Fachmann Jay Rosen 2018 in seinem Offenen Brief. „Ihre Aufgabe ist es, [die Leute] auf Dinge aufmerksam zu machen, über die sie nachdenken sollten.“
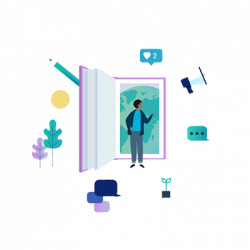 Wir könnten uns darum zum Beispiel entscheiden, nur noch Beiträge zur Klimakrise zu veröffentlichen, die nach dem Vorbild des konstruktiven Journalismus’ (auch) eine mögliche Lösung oder Handlungsoption für diesen Aspekt vorstellen. Das ist schließlich etwas, worüber das Publikum nachdenken sollte. Oder stellen wir doch statt der Gefahren besser die Chancen in den Mittelpunkt: Wir haben als Gesellschaft viel zu gewinnen, wenn wir die Klimakrise angehen.
Wir könnten uns darum zum Beispiel entscheiden, nur noch Beiträge zur Klimakrise zu veröffentlichen, die nach dem Vorbild des konstruktiven Journalismus’ (auch) eine mögliche Lösung oder Handlungsoption für diesen Aspekt vorstellen. Das ist schließlich etwas, worüber das Publikum nachdenken sollte. Oder stellen wir doch statt der Gefahren besser die Chancen in den Mittelpunkt: Wir haben als Gesellschaft viel zu gewinnen, wenn wir die Klimakrise angehen.
Zum Ansatz „Aufmerksam-machen“ zählt auch, wie erwähnt, politische Vorschläge, wirtschaftliche Initiativen und gesellschaftliche Pläne routinemäßig auf ihren Beitrag für das Einhalten der 1,5-Grad-Grenze zu prüfen (wozu sich Deutschland schließlich völkerrechtlich verpflichtet hat). Dafür gibt es längst genügend Organisationen und Forscher:innen, die ihre Expertise gern teilen. Wir sollten zudem immer wieder auf den bemerkenswerten wissenschaftlichen Konsens in Grundfragen der Klimaforschung hinweisen. Und wir können dem Publikum dabei helfen, Falschmeldungen schneller zu erkennen, die ihm in den Sozialen Medien begegnen. Zum Beispiel, indem wir die immer wieder gleichen rhetorischen Tricks entlarven und benennen, die solcher Desinformation zugrundeliegen – in der Kommunikationsforschung wird das inzwischen als eine Art Impfung empfohlen.
All das gehört noch zum Abschnitt dieses Texts, wonach wir als Journalist:innen „nicht mehr Teil des Problems sein wollen“. Aber wir nähern uns dem „Teil der Lösung sein wollen“.
Niemand muss den kritischen Geist abschalten oder Fakten verschweigen. Wir können weiterhin unabhängig von Interessengruppen bleiben – und gleichzeitig das große Ziel teilen und dazu beitragen dass es erreicht wird: die Klimakrise abzuwenden
Implizit ging es ja eben im Zusammenhang mit der Informations-Defizit-Hypothese schon darum, dass wir zu Verhaltensänderungen beitragen möchten, ohne sie zu diktieren. Dies können wir auch explizit aussprechen, wenn wir es als generellen Grundsatz und als Ziel unserer Arbeit deklarieren, dass die Menschheit angemessen auf die Klimakrise reagiert und dass deswegen eine gesellschaftliche Transformation nötig ist. Der britische Guardian stellt seine ganze Arbeit unter einen solchen climate pledgeund nennt die Klimakrise das „definierende Thema unserer Zeit“. Journalismus-Projekte wie Grist.org oder mein eigenes bei riffreporter.de (Klima wandeln) zeigen ebenfalls, dass ein solches Bekenntnis nicht den journalistischen Impuls lahmlegt und nicht zu Gemauschel führt. Das Magazin Stern erklärt offen, in Sachen Klimakrise nicht mehr neutral zu sein, die tageszeitung hat sich schon 2020 einer „klimagerechten Sprache“ verpflichtet.
Niemand muss den kritischen Geist abschalten, Entwicklungen wider besseres Wissen schönreden, Fakten verschweigen oder das jeweilige Thema auf andere Art unprofessionell behandeln. Keine Journalist:in muss oder soll zur Aktivist:in werden. Wir alle können weiterhin unabhängig von Interessengruppen, NGOs oder Parteien bleiben, und gleichzeitig das große, allgemeine Ziel, die Klimakrise abzuwenden, offen teilen und dazu beitragen wollen, dass es erreicht wird.
* * *
Als Reiseführer auf diesem Weg in eine neue Form der Kommunikation könnte das „Handbuch Klimakommunikation“ dienen. Manche der Ratschläge in dem Handbuch lassen sich ohne große Abstriche in den journalistischen Alltag einbauen. Andere erfordern von der Einen oder dem Anderen vielleicht mehr Überwindung, sind aber nicht weniger wichtig. Hier eine Auswahl (in deren Verlauf vermutlich für viele Journalist:innen irgendwann der Punkt kommt, wo der Tipp nicht mehr mit dem beruflichen Selbstverständnis zu vereinbaren ist):
Machen wir die Klimakrise greifbar und konkret. Die Folgen sind schließlich bereits hier und jetzt zu spüren: Wetterextreme wie Hitzewellen, Trockenheit aber auch Starkregen oder Starkschneefall nehmen zu – erst im Juli 2021 kostete ein Unwetter über dem Westen Deutschlands Hunderte Menschen ihr Leben. Und die Ursachen der Klimakrise lassen sich in unserem Land erst recht aufzeigen: an der Massentierhaltung, der Entwicklung der Autoflotte, den Braunkohlemeilern und der Energieverschwendung in vielen Wohnhäusern. Wenn wir die Distanz abschmelzen, die viele Menschen zum abstrakten Thema Klimawandel spüren, wird das Thema relevant, und niemand kann es einfach als Problem für Eisbären abtun. Dieser Ratschlag gilt insbesondere auch für Ressorts, die sich bisher von der Klimafrage selten betroffen sahen: von Reise, Sport und Mode bis zur Wirtschaft, wo das Umdenken aber in vielen Redaktionen bereits begonnen hat.
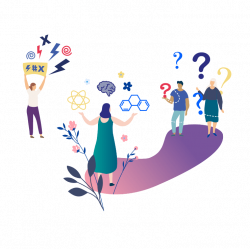 Falls dies aus dem ersten Teil dieses Texts nicht hinreichend klar geworden ist: Konzentrieren wir uns auf Lösungen statt auf Probleme. Und stufen wir die naturwissenschaftliche Klimaforschung zu einer „normalen“ Disziplin zurück, in der es natürlich noch offene Fragen zu klären gibt. Um die Transformation zu begründen, zu beginnen oder voranzutreiben, brauchen wir aber die ausstehenden Detailbefunde der Naturwissenschaften nicht. Stattdessen können und müssen wir längst ausloten, wie es sich in einer klimafreundlichen Gesellschaft der Zukunft leben lässt.
Falls dies aus dem ersten Teil dieses Texts nicht hinreichend klar geworden ist: Konzentrieren wir uns auf Lösungen statt auf Probleme. Und stufen wir die naturwissenschaftliche Klimaforschung zu einer „normalen“ Disziplin zurück, in der es natürlich noch offene Fragen zu klären gibt. Um die Transformation zu begründen, zu beginnen oder voranzutreiben, brauchen wir aber die ausstehenden Detailbefunde der Naturwissenschaften nicht. Stattdessen können und müssen wir längst ausloten, wie es sich in einer klimafreundlichen Gesellschaft der Zukunft leben lässt.
Achten wir verstärkt auf die versteckte Bedeutung von Begriffen. Viele Wörter bringen einen Bedeutungsrahmen mit, aus dem der Empfänger Assoziationen und Bewertungen heraushört, die gar nicht ausgesprochen werden müssen. Dieses Phänomen wird neudeutsch Framing genannt. Ein klares Beispiel dafür ist der Begriff „Flüchtlingswelle“, der nach einer bedrohlichen Naturgewalt klingt. In Wirklichkeit handelt es sich um eine große Zahl hilfebedürftiger Frauen, Männer und Kinder. Auch die Unterscheidung zwischen „Klimawandel“ und „Klimakrise“ macht die Kraft der Assoziationen deutlich: Ersteres klingt eher neutral, letzteres transportiert Gefahr und Dringlichkeit sowie die Notwendigkeit, Entscheidungen zu treffen. In unseren Beiträgen sollten wir darum Begriffe vermeiden, deren Bedeutungsrahmen unsere Absicht konterkariert oder auch nur ungewollt die Absicht von jemand anderem transportiert. Oft sind es gerade die „saftigsten“ O-Töne, die am stärksten auf Framing setzen.
Auch beim Widerlegen von Desinformation spielt Framing eine wichtige Rolle. Übernimmt man die Begriffe derjenigen, die Falschmeldungen verbreiten, spielt man ihnen in die Hände. So oder so werden die Bedeutungsrahmen nämlich erneut verbreitet und tiefer verankert. Sie wirken wie ursprünglich gedacht, auch wenn wir ihnen widersprechen und sie richtigstellen. Besser ist es, als allererstes die korrekte Information zu formulieren, als sei das eine neue Nachricht, um später en passant und paraphrasierend zu erwähnen, zurzeit kursiere übrigens eine Fehlinformation zu diesem Punkt. Das reibt sich zwar an der journalistischen Gewohnheit, früh im Beitrag den sogenannten Aufhänger zu benennen. Doch es dient dem Ziel, das wir mit der Widerlegung eigentlich erreichen wollten.
Noch wirkungsvoller wird dieses Debunking, wenn man wie bereits erwähnt rhetorische Muster erklärt und offenlegt, die in Desinformationskampagnen verwendet werden. In der Berichterstattung über kriminelle Betrugsversuche gibt es ein Vorbild für eine solche Einordnung: Wenn Journalist:innen vom „Enkeltrick“ sprechen, weiß das Publikum das einzuordnen, auch wenn die Details jedes Falles unterschiedlich sind. In der Klimadebatte gibt es einige wiederkehrende „Tricks“, die Erfinder von Falschmeldungen benutzen. Die gängigen Muster von Falschmeldungen findet man bei klimafakten.de unter dem Stichwort PLURV. Diese Abkürzung fasst fünf davon zusammen: Pseudoexperten, Logikfehler, unerfüllbare Erwartungen, Rosinenpicken und Verschwörungsmythen.
Kommunikation weckt Emotionen, das ist unvermeidbar. Wir sollten es nicht als grundsätzlich unjournalistisch ablehnen, Gefühle zu schildern, zu transportieren oder auszulösen (zumal Emotionen bei jeder Entscheidung eine Rolle spielen, wie die Neuroforschung weiß). Aber wir dürfen diese auch nicht als Druckknöpfe missverstehen, mit denen wir gezielt und zuverlässig Reaktionen auslösen können. Als förderlich für das Klimahandeln gelten Hoffnung oder Stolz, eher hinderlich sind Frustration oder Scham oder genauer: das Gefühl, beschämt oder gar gedemütigt worden zu sein. Von den negativen Emotionen kann am ehesten Sorge hilfreich sein, weil sie oft einen kognitiven Kern hat und auf Lösungen fokussiert, während Angst oder Panik eher überwältigen und zum Verkriechen oder Verdrängen verleiten.
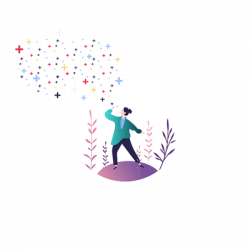 Auf Auslöser von Angst muss die Darstellung einer Lösung folgen. Fehlt sie, führt das zu Fatalismus. Mit bedrohlichen Szenarien eine Reaktion auslösen zu wollen, ist letztlich eine Variante der Informations-Defizit-Hypothese: Wir knallen dem Publikum unerfreuliche Fakten an den Kopf und erwarten, dass es sein Verhalten ändert. Doch wenn es keinen Ausweg zu geben scheint, ist es eine normale psychologische Reaktion, die Gefahr zu bestreiten. Wer Angst macht, sollte daher im nächsten Satz eine brauchbare Handlungsalternative anbieten können. Das wichtigste Gefühl, das der Beitrag dann übermittelt, ist Selbstwirksamkeit: Die Leserin, der Zuschauer versteht, dass sie und er etwas tun können, und dass dies auch etwas bewirkt.
Auf Auslöser von Angst muss die Darstellung einer Lösung folgen. Fehlt sie, führt das zu Fatalismus. Mit bedrohlichen Szenarien eine Reaktion auslösen zu wollen, ist letztlich eine Variante der Informations-Defizit-Hypothese: Wir knallen dem Publikum unerfreuliche Fakten an den Kopf und erwarten, dass es sein Verhalten ändert. Doch wenn es keinen Ausweg zu geben scheint, ist es eine normale psychologische Reaktion, die Gefahr zu bestreiten. Wer Angst macht, sollte daher im nächsten Satz eine brauchbare Handlungsalternative anbieten können. Das wichtigste Gefühl, das der Beitrag dann übermittelt, ist Selbstwirksamkeit: Die Leserin, der Zuschauer versteht, dass sie und er etwas tun können, und dass dies auch etwas bewirkt.
Noch besser ist es, die Kommunikation von vorneherein auf das Positive zu richten. Viele Lösungsansätze führen doch quasi nebenbei dazu, eine bessere Welt zu schaffen. Klimaschutz ist daher keine Belastung, die man wegen seines schlechten Gewissen notgedrungen schultert und gern wieder los wäre: Er ist ein Gewinn an Lebensqualität, weil zum Beispiel die Städte grüner und ruhiger werden. Außerdem bereitet das einmal pro Woche gegessene Stück Biofleisch mehr Genuss als die tägliche Billigwurst – und ist auch noch viel gesünder. Der Fachbegriff für solche erwünschten Nebenwirkungen lautet Co-Benefit, und das wichtigste Beispiel ist Gesundheit: Viele Maßnahmen im Klimaschutz sind gut für Herz, Lunge oder Seele.
Wenn wir das eigene Publikum genau kennen, können wir passende Lösungsansätze vorschlagen. Dabei spielen Werte und Normen eine zentrale Rolle. Wir sollten wissen, was den Frauen und Männern wichtig ist, an die wir uns wenden: was sie erreichen und was sie beschützen wollen. Wenn wir Menschen auf dieser Basis ansprechen, können wir Brücken bauen und sachliche Informationen übermitteln, die dann die richtige Bedeutung finden. Es gelingt jedenfalls besser, als wenn wir es über die rein rationale Schiene versuchen.
Wenn wir als Journalist:innen einen Beitrag dazu leisten wollen, die Klimakrise abzuwenden, muss sich nicht nur der Umfang der Berichterstattung ändern, sondern auch deren Art. Vermeintliche Objektivität kann auf Parteinahme für die Falschen hinauslaufen
Die Psychologie beschreibt die Vielfalt möglicher Werte auf einer zweidimensionalen Karte. Oberbegriffe wie Tradition oder Gemeinwohl sind dort mit weiteren Ausdrücken verknüpft: im ersten Fall zum Beispiel Schicksal, Demut oder Mäßigung, im zweiten Fall Toleranz, Gerechtigkeit oder Verantwortung. Wenn wir solche Wörter gezielt benutzen, können wir den eigenen Beiträgen eine Farbe geben, die das Publikum erkennt.
Kommunikation gelingt oft am besten, wenn sie von einem Themenbotschafter oder einer Themenbotschafterin ausgeht, die bereits zur angesprochenen Gruppe gehört und/oder dort großen Respekt genießt. Solche Personen sind wir Journalist:innen nicht unbedingt, bei Umfragen sprechen Teilnehmer:innen uns als Berufsstand weit weniger Vertrauen aus als Feuerwehrleuten, Handwerkern, Rechtsanwälten oder Verkäufern. (Das Vertrauen in „die Medien“ immerhin ist in der Pandemie etwas gestiegen.) Natürlich ist das Kernpublikum, das unsere Sendungen einschaltet, auf unsere Beiträge klickt oder für unsere Blätter bezahlt, daran interessiert, was wir zu sagen haben. Aber wenn es darum geht, dass die Information Konsequenzen für das eigene Leben hat, nützt der Status einer kenntnisreichen Journalist:in erschreckend wenig. Daraus können wir im ersten Schritt lernen, bei der Auswahl von Interview-Partnerinnen und Zitatgebern auf Vielfalt und Verankerung in wichtigen Zielgruppen zu achten.
* * *
Es steht jeder und jedem frei, die Erkenntnisse zur Klimakommunikation als Baukasten zu verstehen, und sich daraus die Elemente und Ratschläge herauszupicken, die in die eigene Arbeit – und das eigene ethische Gerüst – passen. Doch wenn wir als Journalist:innen tatsächlich einen Beitrag dazu leisten wollen, die Klimakrise abzuwenden, dann muss sich nicht nur der Umfang der Berichterstattung ändern, sondern auch deren Art. Nackte Fakten wehen am Publikum vorbei. Und vermeintliche Objektivität kann auf Parteinahme für die Falschen hinauslaufen. Wie sagte doch der vor kurzem verstorbene südafrikanische Erzbischof Desmond Tutu? „Wenn Du in einer ungerechten Situation neutral bist, hast Du die Seite des Unterdrückers gewählt.“